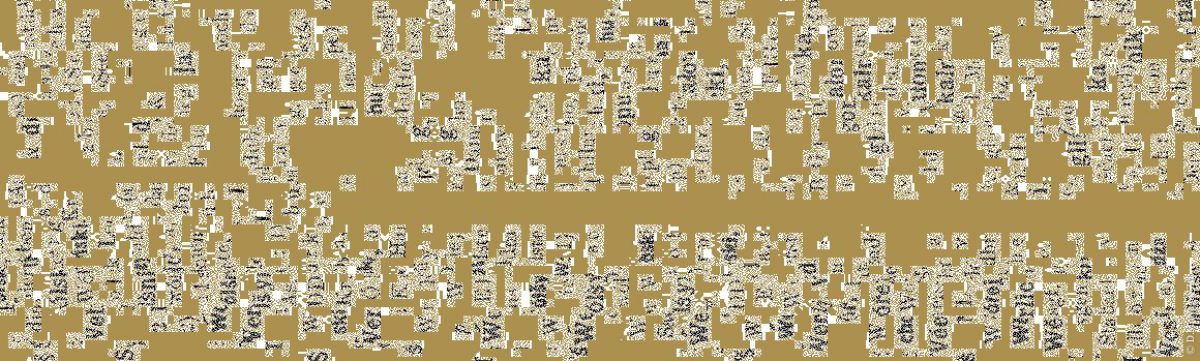Leicht lässt sich das Nachträgliche und Artifizielle an Konstruktionen wie French Theory (oder in jüngerer Zeit auch Italian Theory)[1] herausstellen: Sie unterstellen eine Einheit, wo es keine gibt, scheren Theoretiker*innen verschiedenster Hintergründe und mit unterschiedlichsten Interessen über einen Kamm.[2] Dennoch bietet die Rede von einer French Theory – im Gegensatz zu den ebenfalls außerhalb von Frankreich entstandenen und popularisierten Sammelbegriffen Poststrukturalismus oder Postmoderne – einige Vorteile. Sie verpflichtet die disparaten Theorien erstens nicht auf ein gemeinsames Programm und verweist zweitens darauf, dass die Produktion von Theorie an einem bestimmten Ort geschieht, in diesem Fall im Frankreich der 1960er und 1970er Jahre, und ihre Entstehung an einen gesellschaftlich-politischen Kontext sowie an institutionelle Rahmenbedingungen gebunden ist. In jüngerer Vergangenheit drängt sich zunehmend die Frage nach einer möglichen Brazilian Theory auf. Bereits 2014 erschien in Deutschland, allerdings in englischer Sprache, unter dem Titel The Forest and the School eine erste Anthologie.[3] In den folgenden Jahren nahm das Interesse an Theorie aus (und über) Brasilien spürbar zu, was sich nicht zuletzt in einer Reihe von Übersetzungen niederschlug.[4] Als Timo Luks diese Entwicklung 2020 unter dem Titel »Brasilianische Interventionen« im Merkur reflektierte, konnte er bereits feststellen: »Brasilen ist Gegenstand unseres Nachdenkens und Provokation für unser Denken«.[5] Selbst von einer sich andeutenden »Brasilianisierung der Theorie« ist hier die Rede. „Oliver Precht: GIBT ES EINE »BRAZILIAN THEORY«?“ weiterlesen