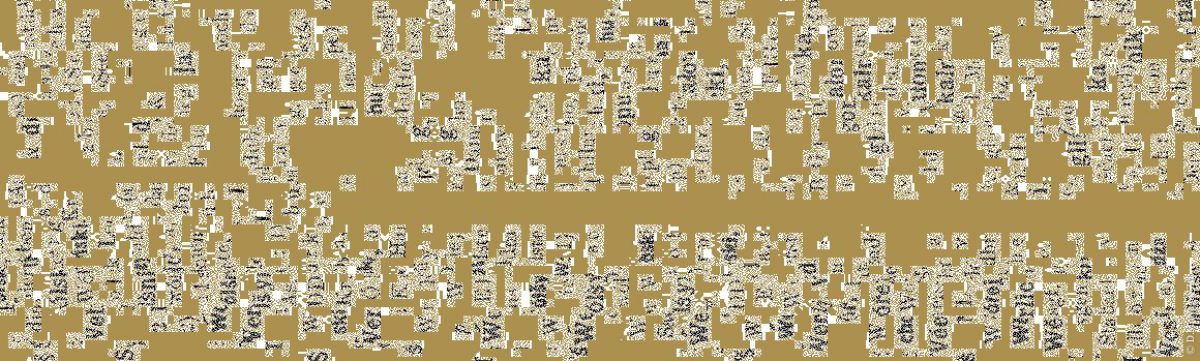Dass das ZfL ihn seit Kurzem als Senior Fellow führt, passt so gar nicht zu der ungestümen Neugierde und den kreativen Energien, die sich Detlev Schöttker nicht nur bewahrt hat, sondern die jüngst über der Beschäftigung mit einem neuen Gegenstand eine neue Qualität gewonnen haben. Instantan, vehement und bedingungslos hat er sich nach dem Umzug des ZfL nach Wilmersdorf in ein neues Forschungsprojekt weniger vertieft als gestürzt. Doch recht besehen ist es kein neuer Gegenstand, sondern es sind seine alten Bekannten, die ihm rund um den Fasanenplatz wiederbegegnen. Ein größeres Geschenk als diese Nachbarschaft hätte man ihm vielleicht nicht machen können: Die literarische und kulturelle Moderne entstand hier! Der Fasanenplatz ist ein ›Freilichtmuseum‹ der Moderne mit Hauptmann, Brecht, Benjamin und vielen anderen. Und Detlev Schöttker wäre nicht Detlev Schöttker, wenn er die Öffentlichkeit nicht sogleich über einige seiner Funde und Entdeckungen informiert hätte. In der FAZ sind bereits mehrere Artikel von ihm über die erstaunliche Bedeutung unseres Kiezes für die Moderne erschienen. „Eva Geulen: Mann der Moderne ohne Wenn und Aber: DETLEV SCHÖTTKER ZUM 70. GEBURTSTAG“ weiterlesen
Kategorie: EINBLICK
Isabel Jacobs/Martin Küpper: Philosopher of the Ideal: EVALD ILYENKOV AT 100
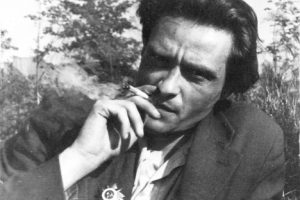
February 18th 2024 marked the centenary of the birth of Evald Ilyenkov (1924–1979) – a brilliant and influential Soviet philosopher whose most important early works remained unpublished during his lifetime (fig. 1). Two days before Ilyenkov’s 100th birthday, Russian opposition leader Alexei Navalny was found dead in a Siberian prison colony; that news overshadowed the little attention given to Ilyenkov’s anniversary in Russia. The manner in which Ilyenkov’s centenary and Navalny’s death were treated reflects memory culture in Putin’s Russia, where the legacies of Soviet Marxism are often suppressed by ultra-nationalist propaganda. Abroad, Ilyenkov’s prestige has seen a remarkable rise in recent years, accompanied by translations and new scholarship in, for example, Sweden, Ukraine, Peru, Turkey, Canada and Cuba. „Isabel Jacobs/Martin Küpper: Philosopher of the Ideal: EVALD ILYENKOV AT 100“ weiterlesen
Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR
»Erst der neue Zweck macht die neue Kunst«, erklärte Bertolt Brecht in seinem kurzen Essay Über Stoffe und Formen von 1929.[1] Formuliert als Begründung für die Entwicklung seiner Lehrstücke um 1930, liefert Brechts Äußerung einen Zugang zu den Debatten über den politischen Nutzen von Literatur nicht nur in der Zwischenkriegszeit, sondern auch in unserer Gegenwart. Obwohl die Äußerung den Anschein eines unerschütterlichen künstlerischen Dogmas hat, verbleibt sie in einer ambivalenten Schwebe zwischen zwei scheinbar konträren Positionen in Bezug auf die eigentlichen Verpflichtungen engagierter Kunst. Einerseits scheint Brechts Satz auf dem absoluten Vorrang des politischen Engagements vor ästhetischen Belangen zu bestehen, indem er suggeriert, dass die inneren Funktionsweisen der Literatur notwendigerweise einem äußeren (d.h. politischen oder gesellschaftlichen) Zweck untergeordnet sind; andererseits behauptet er, dass Politik für den Künstler nur insofern von Wert ist, als sie eine radikale Umgestaltung der Muster und Formen der Kunst ermöglicht. Anders ausgedrückt: Künstlerische Innovationen scheinen ohne eine vorherige Verpflichtung auf (politische oder gesellschaftliche) Zwecke, die als außerhalb der Kunst liegend vorgestellt werden, undenkbar zu sein. Doch gleichzeitig muss, was die Arbeit des Schriftstellers betrifft, der Wert dieser ›vorherigen‹ Verpflichtungen an ihrem Vermögen gemessen werden, neue ästhetische Formen hervorzubringen. Brecht zufolge birgt die Frage nach den Verpflichtungen der Kunst eine unauflösbare Dialektik: Kunst und politischer Zweck sind einander nicht äußerlich, ihre Beziehung ist nicht durch Konflikt oder gegenseitigen Ausschluss gekennzeichnet, sondern vielmehr durch das Versprechen schöpferischer Reibung und gegenseitiger Bereicherung. „Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR“ weiterlesen
Sandra Folie: ASPEKTE SCHWARZER GESCHICHTE(N) IN »BERLIN GLOBAL«. Eine Führungs- und Ausstellungsreflexion
Februar ist Black History Month[1] und damit der ideale Zeitpunkt, eine Blogserie über Berliner Orte zu beginnen, die wir – Gianna Zocco und Sandra Folie – im Zuge unseres neuen Forschungsprojekts »Schwarze Narrative transkultureller Aneignung« besuchen: Museen, Theater, Verlage, Archive usw., die für eine afroeuropäisch fokussierte Literatur- und Kulturforschung relevant sind und mit denen wir ins Gespräch kommen wollen.[2] Die erste Exkursion führte mich zur Ausstellung BERLIN GLOBAL im Humboldt Forum, die zu zeigen versucht, »wie die Stadt und ihre Menschen mit der Welt verbunden sind«[3]. Sie beruft sich dabei auf eine vielstimmige, partizipative Konzeption und Umsetzung und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema des Kolonialismus und seinen Nachwirkungen.
Unter dem Titel »Sichtbar werden« führten eine externe afrodeutsche Expertin und eine Museumsvermittlerin im Gespräch – miteinander, aber auch mit der Gruppe – durch die Spuren Schwarzer[4] Geschichte(n) in der Ausstellung.[5] Welche Aspekte Schwarzer Geschichte(n) müssen aber in einer solchen Ausstellung erst im Rahmen einer speziellen Führung »sichtbar werden«, fragte ich mich vorab. Und würde sich die Führung mit ihrem Anspruch der Sichtbarmachung als ein Akt des narrating back und damit der partiellen oder temporären Aneignung eines (zu) weiß kodierten Raumes wie des Humboldt Forums[6] begreifen lassen? „Sandra Folie: ASPEKTE SCHWARZER GESCHICHTE(N) IN »BERLIN GLOBAL«. Eine Führungs- und Ausstellungsreflexion“ weiterlesen
Patrick Eiden-Offe: EDITIONSPHILOLOGIE ALS AKTIVISMUS: Der umkämpfte Hölderlin
In Erinnerung an Marianne Schuller
Am 6. August 1975 lädt der Verlag Roter Stern in Frankfurt am Main zu einer Pressekonferenz ins Hotel Frankfurter Hof. Hier präsentieren der Verleger KD Wolff, ehedem Bundesvorsitzender des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, und der ehemalige Werbegrafiker D. E. Sattler den Einleitungsband ihrer neuen Hölderlin-Ausgabe. Die zwanzigbändige Edition soll in fünf Jahren abgeschlossen sein; tatsächlich erscheint der letzte Band 2008. Aufsehenerregend war die neue Ausgabe vor allem wegen ihrer Editionsprinzipien: Alle Handschriften werden im Faksimile wiedergegeben, eine »typographische Umschrift« bildet die Schriftbildlichkeit der Handschriftenblätter ab, eine »Phasenanalyse« macht den zeitlichen Charakter des Entwurfsprozesses nachvollziehbar. Aufsehenerregend war aber auch, dass die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe (FHA) von Anfang an unter einem politisch-aktivistischen Stern stand: »Roter Stern über Hölderlin« oder »Liest Marx jetzt Hölderlin?« lauteten einschlägige Überschriften in der Presse. „Patrick Eiden-Offe: EDITIONSPHILOLOGIE ALS AKTIVISMUS: Der umkämpfte Hölderlin“ weiterlesen
Nina Weller: WISSENSCHAFTSAKTIVISMUS UND OSTEUROPAFORSCHUNG IN ZEITEN DES KRIEGES
Mit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine ist die Osteuropaforschung, die in der Öffentlichkeit jahrzehntelang eine eher marginale Rolle spielte, ins Rampenlicht gerückt. Osteuropawissenschaftler:innen analysieren das laufende Kriegsgeschehen, erläutern vorangegangene Entwicklungen, informieren über die russische Imperialgeschichte und das lange Ringen der Ukraine und anderer ehemaliger Sowjetrepubliken um Unabhängigkeit. Kurz: Sie vermitteln komplexes Wissen über Politik und Geschichte, Sprache und Kultur eines Raums, der von jahrhundertelangen Grenzverschiebungen, vielsprachigen und multireligiösen Bevölkerungen und generationsübergreifenden Gewalterfahrungen gekennzeichnet ist. „Nina Weller: WISSENSCHAFTSAKTIVISMUS UND OSTEUROPAFORSCHUNG IN ZEITEN DES KRIEGES“ weiterlesen
Henning Trüper: AKTIVISMUS UND KULTURGESCHICHTE DES MORALISCHEN
›Aktivismus‹ wird heute kontextabhängig in vielen Bedeutungen verwendet: als deskriptive Bestimmung, positiver Identifikationsbegriff, Begriff der polemischen Abwertung oder Zielscheibe jargonkritischen Spotts.[1] Im Kern des Begriffs behauptet sich aber stets die individuelle Partizipation am kollektiven gesellschaftlichen Handeln, insbesondere an der Politik. Meist wird als Aktivismus die emphatische Teilnahme an sozialen Bewegungen emanzipatorischer Art bezeichnet. Es geht dabei häufig um marginalisierte Gruppen und Anliegen. Forderungen nach Ermächtigung und Gleichberechtigung sowie die Herausstellung besonderer Schutzbedürftigkeit stehen im Zentrum. Auch im aktivistischen Umgang mit dem Klimawandel bleibt der Grundgedanke des Schutzes – nun nicht mehr nur menschlicher Akteure, sondern einer ihrer Rechte beraubten Natur – erkennbar. „Henning Trüper: AKTIVISMUS UND KULTURGESCHICHTE DES MORALISCHEN“ weiterlesen
Eva Geulen: Jahresthema 2023/24, AKTIVISMUS UND WISSENSCHAFT
In den aktuellen Debatten um politischen Aktivismus und institutionalisierte Wissenschaft lässt sich unschwer das alte Muster ›Elfenbeinturm‹ vs. Engagement erkennen, das zahlreiche Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert geprägt hat. Angesichts dieser langen, wechselvollen und produktiven Geschichte könnte man mit dem Thema eigentlich gelassener umgehen als der aufgeregte Ton heute nahelegt. In ihrem Beitrag zu den Osteuropawissenschaften in Zeiten des Krieges wundert sich auch Nina Weller, dass längst überwunden geglaubte Fronten sich neu formieren. Henning Trüper erinnert daran, dass moderne Wissenschaft immer von politischen Instanzen wie dem Staat abhängt. Patrick Eiden-Offe stellt anhand der Frankfurter Hölderlin-Edition, deren politische Motive einen Paradigmenwechsel in der Editionswissenschaft herbeiführten, die Verträglichkeit von Politik und Wissenschaft exemplarisch unter Beweis. Er zeigt aber auch, dass dem akademischen Erfolg des Projektes dessen politische Motive zum Opfer fielen; bei der Durchsetzung neuer Editionsprinzipien blieb der politisch-aktivistische Impuls auf der Strecke. „Eva Geulen: Jahresthema 2023/24, AKTIVISMUS UND WISSENSCHAFT“ weiterlesen
Lukas Laier: EDIEREN AUS DEM NACHLASS. Zur Werkausgabe Hermann Borchardts
So abenteuerlich die Wege von deutschen Exilschriftstellerinnen und -schriftstellern des letzten Jahrhunderts waren, so verworren sind meist auch die Wege ihrer Nachlässe. Selten finden sich alle Manuskripte, Briefe und persönlichen Gegenstände an einem Ort versammelt. Häufig verteilen sich Nachlässe auf verschiedene Orte und Länder. Im schlimmsten Fall hat überhaupt niemand etwas aufbewahrt. Der Nachlass des Schriftstellers und Philosophen Hermann Borchardt (1888–1951) findet sich an zwei Standorten: im Deutschen Exilarchiv 1933–1945 in Frankfurt am Main, wohin ihn der verdienstvolle Exilforscher John M. Spalek überführte, und in der Rubenstein Rare Book & Manuscript Library in Durham, North Carolina. Ein unerwarteter Fund, den mein Kollege Christoph Hesse und ich dort machten, veranlasste uns, Borchardt mit einer Werkedition als wichtigen Schriftsteller des Exils zu würdigen. „Lukas Laier: EDIEREN AUS DEM NACHLASS. Zur Werkausgabe Hermann Borchardts“ weiterlesen
Franziska Thun-Hohenstein: ANDREJ TARKOVSKIJS »SOLARIS«. Ein Wiedersehen
I.
Ende 1972, vielleicht war es auch Anfang 1973, lief im Hauptgebäude der Moskauer Lomonossow-Universität eine Voraufführung von Andrej Tarkovskijs Spielfilm Solaris. Auf einer Forschungsstation über dem riesigen Ozean des Planeten Solaris soll der Psychologe Chris Kelvin dabei helfen, seltsame Vorgänge aufzuklären. Die Wissenschaftler werden dort von menschlichen Wesen ›besucht‹, die Projektionen ihrer eigenen quälenden Erinnerungen sind. Ohne die Aussicht, das Rätsel des Ozeans je zu lösen und ins Vaterhaus auf der Erde zurückzukehren, bleibt Kelvin schließlich auf der Station.
Ich hatte das Glück, bei der einmaligen Filmvorführung dabei zu sein.[1] Aus der DDR kommend, war ich damals Studentin der russischen Sprache und Literatur an der Lomonossow-Universität und wohnte im Wohnheim in einem Seitenflügel des markanten Stalinhochhauses auf den Sperlingsbergen, die damals Leninberge hießen. Das genaue Datum vermag ich nicht mehr zu rekonstruieren. Der Kinoabend ist mir allerdings schon durch seine ungewöhnlichen äußeren Umstände in Erinnerung geblieben. An Eintrittskarten gelangten meine Freunde und ich nur, weil die russische Freundin eines DDR-Promotionsstipendiaten an der Kasse aushalf. Der Andrang unmittelbar vor der Aufführung war enorm. Im Innern, im Vestibül des Kulturhauses, das sich im Hauptgebäude befindet, versuchte berittene Miliz der von außen immer weiter nachdrängenden Massen Herr zu werden. Ihr Anblick erschreckte mich, obwohl kaum mehr als ein oder zwei Pferde in den Raum gepasst haben konnten. „Franziska Thun-Hohenstein: ANDREJ TARKOVSKIJS »SOLARIS«. Ein Wiedersehen“ weiterlesen