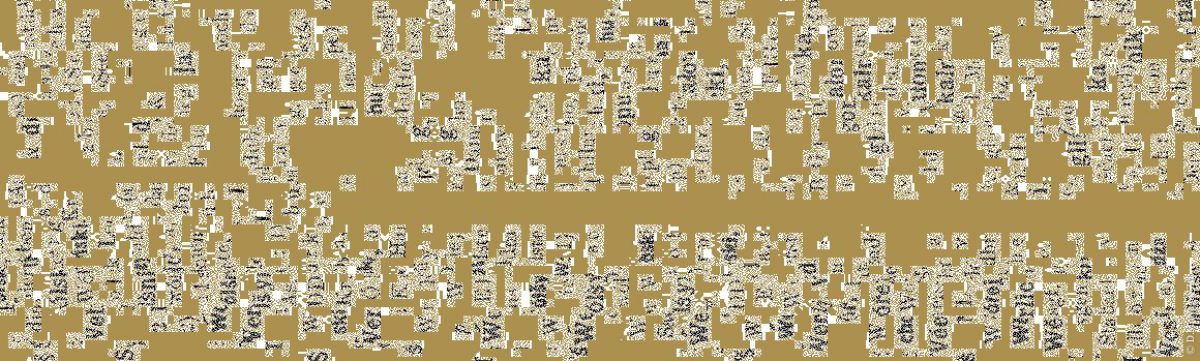Einige Beiträge zum aktuellen ZfL-Jahresthema erinnerten zuletzt an dieser Stelle daran, dass das Begriffspaar »Aktivismus und Wissenschaft« von einem alten Spannungsverhältnis geprägt ist, welches sich gegenwärtig wieder bemerkbar macht. Eva Geulen etwa verweist auf den etliche Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert kennzeichnenden Gegensatz zwischen einer sich weltfremd im Elfenbeinturm ereignenden vita contemplativa und einer sich engagiert-praktisch gestaltenden vita activa. Zur Veranschaulichung nennt sie eine »Kontroverse zwischen Herbert Marcuse und Jürgen Habermas aus den späten 1960er Jahren«, in der Aspekte des Verhältnisses von Theorie und Praxis verhandelt wurden. In der Folge wird die Frage aufgeworfen, ob denn die Polarität von »›Elfenbeinturm‹ vs. Engagement« unter heutigen Bedingungen so noch bestehe oder ob wir es nicht eher »mit einer bisher unbekannten Konvergenz eines Aktivismus ›von oben‹ und ›von unten‹ zu tun« haben. „Sebastian Truskolaski: AKTIVISMUS, OFFENSIV UND POLEMISCH: Randbemerkung zur Frühgeschichte eines Begriffs“ weiterlesen
Schlagwort: Literaturwissenschaft
Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR
»Erst der neue Zweck macht die neue Kunst«, erklärte Bertolt Brecht in seinem kurzen Essay Über Stoffe und Formen von 1929.[1] Formuliert als Begründung für die Entwicklung seiner Lehrstücke um 1930, liefert Brechts Äußerung einen Zugang zu den Debatten über den politischen Nutzen von Literatur nicht nur in der Zwischenkriegszeit, sondern auch in unserer Gegenwart. Obwohl die Äußerung den Anschein eines unerschütterlichen künstlerischen Dogmas hat, verbleibt sie in einer ambivalenten Schwebe zwischen zwei scheinbar konträren Positionen in Bezug auf die eigentlichen Verpflichtungen engagierter Kunst. Einerseits scheint Brechts Satz auf dem absoluten Vorrang des politischen Engagements vor ästhetischen Belangen zu bestehen, indem er suggeriert, dass die inneren Funktionsweisen der Literatur notwendigerweise einem äußeren (d.h. politischen oder gesellschaftlichen) Zweck untergeordnet sind; andererseits behauptet er, dass Politik für den Künstler nur insofern von Wert ist, als sie eine radikale Umgestaltung der Muster und Formen der Kunst ermöglicht. Anders ausgedrückt: Künstlerische Innovationen scheinen ohne eine vorherige Verpflichtung auf (politische oder gesellschaftliche) Zwecke, die als außerhalb der Kunst liegend vorgestellt werden, undenkbar zu sein. Doch gleichzeitig muss, was die Arbeit des Schriftstellers betrifft, der Wert dieser ›vorherigen‹ Verpflichtungen an ihrem Vermögen gemessen werden, neue ästhetische Formen hervorzubringen. Brecht zufolge birgt die Frage nach den Verpflichtungen der Kunst eine unauflösbare Dialektik: Kunst und politischer Zweck sind einander nicht äußerlich, ihre Beziehung ist nicht durch Konflikt oder gegenseitigen Ausschluss gekennzeichnet, sondern vielmehr durch das Versprechen schöpferischer Reibung und gegenseitiger Bereicherung. „Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR“ weiterlesen
Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS
Die Ausgabe Nr. 17 vom Oktober 2022 der chilenischen Kulturzeitschrift Papel Máquina ist der Arbeit der ehemaligen Direktorin des ZfL Sigrid Weigel gewidmet. Wir danken der Schriftstellerin Yoko Tawada für die Erlaubnis, ihren dort in spanischer Übersetzung erschienenen Beitrag im ZfL BLOG erstmals in der deutschen Originalfassung veröffentlichen zu dürfen.
Neulich nahm ich ein Buch von Sigrid Weigel in die Hand, das 1982 erschienen ist. Normalerweise bleiben alle Buchtitel auf einer Publikationsliste brav in einer chronologischen Reihe, und selbst wenn die Schlange sehr lang ist, was bei Weigel zweifellos der Fall ist, springt keiner von ihnen aus der Reihe und rennt nach vorne, in Richtung Zukunft. Aber es kommt doch vor, dass man, zum Beispiel bei einem Umzug, eines der Frühwerke in die Hand nimmt und darin blättert. Man wird überrascht von schillernden Denkbildern, die von heute sein könnten. Ansätze und Zusammenhänge, die man einer späteren Phase zugeordnet hätte, oder solche, die man jetzt erst begreift, stehen bereits in den älteren Büchern schwarz auf weiß. Gerade im digitalen Zeitalter, in dem die historischen Rahmen verschwimmen, gefällt mir die Unbestechlichkeit des Papiers, das die Zeit nie schleichend verfälscht. „Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS“ weiterlesen
Eva Geulen: »JEDER BEKOMMT SEINE KINDHEIT ÜBER DEN KOPF GESTÜLPT …«
Die Redaktion von »leibniz« hat für die Ausgabe ihres Magazins zum Thema »Anfänge« (Heft 3, 2020) dreizehn Menschen aus der Leibniz-Gemeinschaft gebeten, ihre liebsten ersten Sätze kurz zu kommentieren. Eva Geulen, Direktorin des ZfL, hat hierfür einen Satz aus Heimito von Doderers Roman »Ein Mord den jeder begeht« ausgewählt. Wir veröffentlichen auf unserem Blog die Langfassung ihres Textes. „Eva Geulen: »JEDER BEKOMMT SEINE KINDHEIT ÜBER DEN KOPF GESTÜLPT …«“ weiterlesen
Insa Braun: WRESTLING UM WAHRHAFTIGKEIT: Clemens Setz und Christian Kracht
Innerhalb nur eines Jahres haben sich zwei Autoren im deutschsprachigen Literaturbetrieb öffentlich zu Wort gemeldet und der Literaturkritik wie der Literaturwissenschaft eine Lehre erteilt: Christian Kracht und Clemens Setz. Die beiden Reden sollten wir uns merken. „Insa Braun: WRESTLING UM WAHRHAFTIGKEIT: Clemens Setz und Christian Kracht“ weiterlesen
Eva Axer, Werner Michler, Marjorie Levinson: DIE ›NEUEN FORMALISMEN‹ – FORM, GESCHICHTE, GESELLSCHAFT. Drei Beiträge
Während man in Deutschland die Debatte um eine mögliche ›Rephilologisierung‹ der Literaturwissenschaft abermals zu entzünden sucht, ist in den USA der ebenfalls seit Ende der 1990er Jahre geführte Methodenstreit um die ›neuen Formalismen‹ in der Literaturtheorie bereits neuerlich entbrannt. Hier wie dort steht (nochmalig) zur Diskussion, wie Literatur als wissenschaftlicher Gegenstand konstituiert werden solle, was das ›Kerngeschäft‹ der Literaturwissenschaft sei und wie sie sich zu anderen Disziplinen ins Verhältnis zu setzen habe. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen sich eine immanent operierende, auf formale Aspekte fokussierte Lektürepraxis und eine historisch-kontextualisierende Herangehensweise so antagonistisch gegenüberstehen wie etwa im Fall von New Criticism und New Historicism. Gleichwohl bleibt der Stellenwert von Formfragen ein gewichtiges, vielleicht entscheidendes Moment der Debatten. Von Belang ist die aktuelle Diskussion in den USA zum einen, weil die neuen formalistischen Ansätze eben nicht mehr nur unter Ausschließung historischer oder kulturwissenschaftlicher Problemstellungen verfahren; zum anderen, weil dort eine (wissenschafts‑)politische Dimension dieser Fragen ins Licht rückt. In den folgenden Beiträgen, die im Anschluss an den ZfL-Workshop »Die ›neuen Formalismen‹ – Form, Geschichte, Gesellschaft« entstanden sind, diskutieren Eva Axer, Werner Michler und Marjorie Levinson die Konjunktur des Formbegriffs und der ›neuen Formalismen‹. „Eva Axer, Werner Michler, Marjorie Levinson: DIE ›NEUEN FORMALISMEN‹ – FORM, GESCHICHTE, GESELLSCHAFT. Drei Beiträge“ weiterlesen
Angus Nicholls: WHAT IS ‘PROGRESS’ IN THE HUMANITIES? (As Seen from the Perspective of Literary Studies)
If one thing can be learned from the recent boom in the apparently ‘new’ field of the ‘history of the humanities’, it is that, especially in the humanities, the history of an academic discipline is never mere history, because the research questions that inaugurate a discipline continue to subsist at its foundations. Knowledge in the humanities, it seems, develops differently. In many fields, ‘progress’ is far less linear than in the natural sciences; indeed, research programmes may shuttle back and forth between different epochs, with interpretations of the past continually shedding new light upon the present. „Angus Nicholls: WHAT IS ‘PROGRESS’ IN THE HUMANITIES? (As Seen from the Perspective of Literary Studies)“ weiterlesen
Eva Axer: #KleineFormen. Ein Sammelband eröffnet neue medien- und wissensgeschichtliche Perspektiven
Als Blogeintrag darf man diesen Text zu den sogenannten kleinen Formen zählen, die Wert auf Kürze und Prägnanz legen. Allerdings beklagte bereits Alfred Polgar, der den Begriff der kleinen Form in den 1920er Jahren prägte, das folgenreiche Missverständnis, dass ein Text, der sich in fünf Minuten lesen lässt, eine geeignete Lektüre sei, wenn man nur fünf Minuten Zeit hat (in der Straßenbahn etwa oder in der Mittagspause). Kleine Formen seien, so Polgar, keineswegs literarische ›Leichtgewichte‹, sondern zeitgemäße Literatur für ein hektisches Zeitalter. Dass literarische Verfahren der Verkürzung gerade auch gegenteilige Effekte für die Rezeption haben können, die dann sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als die bloße Lektüre, war ihm natürlich bewusst. „Eva Axer: #KleineFormen. Ein Sammelband eröffnet neue medien- und wissensgeschichtliche Perspektiven“ weiterlesen
Daniel Weidner: DIE WELT IST NICHT GENUG. Ottmar Ette über die »Literaturen der Welt«
›Weltliteratur‹ ist heute in aller Munde. Längst bezeichnet der Ausdruck nicht mehr einfach eine Menge von Texten, sondern steht für einen Diskurs über das Selbstverständnis der Literaturwissenschaft jenseits der Nationalphilologien. Vor allem im angloamerikanischen Raum wird world literature heiß diskutiert, und inzwischen nimmt die Diskussion auch in Deutschland Fahrt auf: Das nächste DFG-Symposium der Literaturwissenschaft, Flaggschiff der Disziplin, wird den Titel »Vergleichende Weltliteraturen« tragen. Verhandelt werden dabei wohl kaum die Literaturen verschiedener Welten – Romane der Marsianer … –, auch wird hoffentlich nicht einfach das Thema über den komparatistischen Leisten gezogen, sondern es werden verschiedene Konzepte und Diskurse der Weltliteratur verglichen werden. Ein solches Konzept entwirft auch Ottmar Ettes jüngster Band WeltFraktale. Wege durch die Literaturen der Welt (Stuttgart: Metzler, 2017). „Daniel Weidner: DIE WELT IST NICHT GENUG. Ottmar Ette über die »Literaturen der Welt«“ weiterlesen