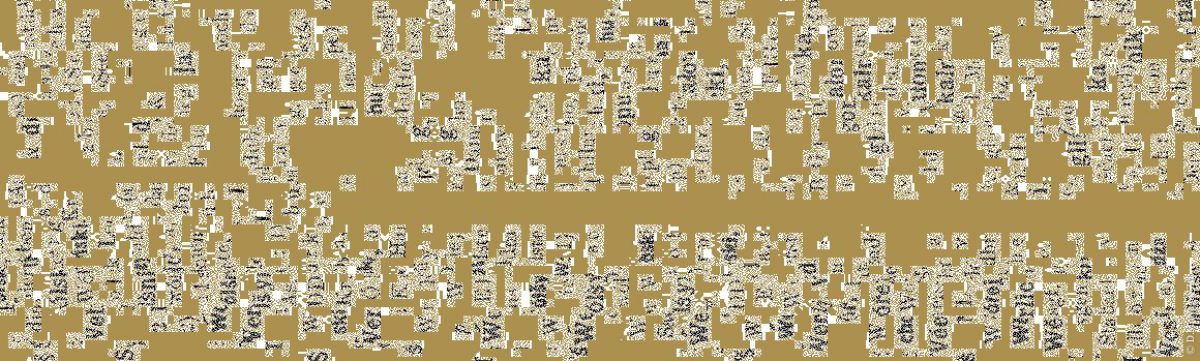Zum Jahreswechsel 2023/2024 gelang einer russischen Fernsehserie, was während Russlands Krieg gegen die Ukraine eigentlich unvorstellbar scheint: Innerhalb weniger Tage entwickelte sich Ehrenwort eines Kerls. Blut auf dem Asphalt (Slowo pazana. Krow na asfalte, 2023) beiderseits der Schützengräben zur populärsten Serie des Jahres. Die Zuschauer- und Klickzahlen erreichten Rekordhöhen und der Titelsong Pyjala (dt. ›Glas‹) der tatarischen Band Aigel schaffte es an die Spitze diverser Hitparaden in beiden Ländern.[1] In der Russischen Föderation war die Serie zwar mit der Altersgrenze »18+« versehen und nur bei den privaten Streamingdiensten Wink und START zu sehen.[2] Doch schon während der Ausstrahlung der acht Folgen der ersten Staffel vom 9. November bis 21. Dezember 2023 verbreitete die Serie sich blitzschnell über Telegram und andere digitale Kanäle. Sätze wie »Kerle entschuldigen sich nicht« oder »Denk dran, du bist jetzt ein Kerl, du bist jetzt auf der Straße, und ringsherum sind Feinde« wurden zu geflügelten Worten. Pädagogen und Politikerinnen schlugen Alarm, als in der Presse Berichte auftauchten, die von durch die Serie inspirierten Schlägereien berichteten, und zwar sowohl in Russland als auch in der Ukraine.[3] „Matthias Schwartz: IN DER WELT DER WILDEN KERLE. Eine populäre Serie im Zeichen des russisch-ukrainischen Krieges“ weiterlesen
Kategorie: AD HOC
Eva Geulen: Mann der Moderne ohne Wenn und Aber: DETLEV SCHÖTTKER ZUM 70. GEBURTSTAG
Dass das ZfL ihn seit Kurzem als Senior Fellow führt, passt so gar nicht zu der ungestümen Neugierde und den kreativen Energien, die sich Detlev Schöttker nicht nur bewahrt hat, sondern die jüngst über der Beschäftigung mit einem neuen Gegenstand eine neue Qualität gewonnen haben. Instantan, vehement und bedingungslos hat er sich nach dem Umzug des ZfL nach Wilmersdorf in ein neues Forschungsprojekt weniger vertieft als gestürzt. Doch recht besehen ist es kein neuer Gegenstand, sondern es sind seine alten Bekannten, die ihm rund um den Fasanenplatz wiederbegegnen. Ein größeres Geschenk als diese Nachbarschaft hätte man ihm vielleicht nicht machen können: Die literarische und kulturelle Moderne entstand hier! Der Fasanenplatz ist ein ›Freilichtmuseum‹ der Moderne mit Hauptmann, Brecht, Benjamin und vielen anderen. Und Detlev Schöttker wäre nicht Detlev Schöttker, wenn er die Öffentlichkeit nicht sogleich über einige seiner Funde und Entdeckungen informiert hätte. In der FAZ sind bereits mehrere Artikel von ihm über die erstaunliche Bedeutung unseres Kiezes für die Moderne erschienen. „Eva Geulen: Mann der Moderne ohne Wenn und Aber: DETLEV SCHÖTTKER ZUM 70. GEBURTSTAG“ weiterlesen
Isabel Jacobs/Martin Küpper: Philosopher of the Ideal: EVALD ILYENKOV AT 100
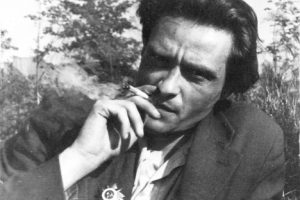
February 18th 2024 marked the centenary of the birth of Evald Ilyenkov (1924–1979) – a brilliant and influential Soviet philosopher whose most important early works remained unpublished during his lifetime (fig. 1). Two days before Ilyenkov’s 100th birthday, Russian opposition leader Alexei Navalny was found dead in a Siberian prison colony; that news overshadowed the little attention given to Ilyenkov’s anniversary in Russia. The manner in which Ilyenkov’s centenary and Navalny’s death were treated reflects memory culture in Putin’s Russia, where the legacies of Soviet Marxism are often suppressed by ultra-nationalist propaganda. Abroad, Ilyenkov’s prestige has seen a remarkable rise in recent years, accompanied by translations and new scholarship in, for example, Sweden, Ukraine, Peru, Turkey, Canada and Cuba. „Isabel Jacobs/Martin Küpper: Philosopher of the Ideal: EVALD ILYENKOV AT 100“ weiterlesen
Sandra Folie: ASPEKTE SCHWARZER GESCHICHTE(N) IN »BERLIN GLOBAL«. Eine Führungs- und Ausstellungsreflexion
Februar ist Black History Month[1] und damit der ideale Zeitpunkt, eine Blogserie über Berliner Orte zu beginnen, die wir – Gianna Zocco und Sandra Folie – im Zuge unseres neuen Forschungsprojekts »Schwarze Narrative transkultureller Aneignung« besuchen: Museen, Theater, Verlage, Archive usw., die für eine afroeuropäisch fokussierte Literatur- und Kulturforschung relevant sind und mit denen wir ins Gespräch kommen wollen.[2] Die erste Exkursion führte mich zur Ausstellung BERLIN GLOBAL im Humboldt Forum, die zu zeigen versucht, »wie die Stadt und ihre Menschen mit der Welt verbunden sind«[3]. Sie beruft sich dabei auf eine vielstimmige, partizipative Konzeption und Umsetzung und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema des Kolonialismus und seinen Nachwirkungen.
Unter dem Titel »Sichtbar werden« führten eine externe afrodeutsche Expertin und eine Museumsvermittlerin im Gespräch – miteinander, aber auch mit der Gruppe – durch die Spuren Schwarzer[4] Geschichte(n) in der Ausstellung.[5] Welche Aspekte Schwarzer Geschichte(n) müssen aber in einer solchen Ausstellung erst im Rahmen einer speziellen Führung »sichtbar werden«, fragte ich mich vorab. Und würde sich die Führung mit ihrem Anspruch der Sichtbarmachung als ein Akt des narrating back und damit der partiellen oder temporären Aneignung eines (zu) weiß kodierten Raumes wie des Humboldt Forums[6] begreifen lassen? „Sandra Folie: ASPEKTE SCHWARZER GESCHICHTE(N) IN »BERLIN GLOBAL«. Eine Führungs- und Ausstellungsreflexion“ weiterlesen
Elke Schmitter: LET’S CALL IT NACHBARSCHAFT

Im Sommer 2023 zogen das ZfL, das ZAS und die gemeinsame Verwaltung der Geisteswissenschaftlichen Zentren Berlin aus der Schützenstraße in Berlin-Mitte nach Wilmersdorf. In dem an der Pariser Str. 1, Ecke Meierottostr. 8 neu errichteten Gebäude ACHTUNDEINS von Eike Becker_Architekten bespielen die Zentren nun insgesamt drei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich, von außen einsehbar, die Forschungsbibliotheken von ZfL und ZAS sowie der Eberhard-Lämmert-Saal. Während des Neujahrsempfangs, mit dem sich ZfL, ZAS und die GWZ am 11. Januar 2024 der unmittelbaren Nachbarschaft vorstellten, entstand die Idee zu dieser Glosse.
Die Redaktion „Elke Schmitter: LET’S CALL IT NACHBARSCHAFT“ weiterlesen
Tobias Wilke: KI, DIE BOMBE. Zu Gegenwart und Geschichte einer Analogie
»A.I. or Nuclear Weapons: Can You Tell These Quotes Apart?« – so fragte die New York Times ihre Leser:innen am 10. Juni dieses Jahres. In Form eines metadiskursiven Ratespiels rückte die Zeitung damit eine Analogie in den Blick, die in den jüngsten Debatten um Künstliche Intelligenz zu erheblicher Prominenz gelangt ist. Wenn derzeit die Risiken neuester (Sprach-)Technologien beschworen werden, lässt der Vergleich mit dem Vernichtungspotenzial von Atomwaffen nicht lange auf sich warten. Dies gilt für die in Print- und Onlinemedien ausgetragene Diskussion, ist aber auch innerhalb der wissenschaftlichen Community mit ihren Spezialöffentlichkeiten zu beobachten.[1] Warnungen vor den unabsehbaren Folgen der KI-Entwicklung gleichen in ihrer Drastik und teils bis aufs Wort den Mahnrufen und Appellen, mit denen in der Nachkriegszeit auf die damals neue Gefahr eines drohenden globalen Nuklearkonflikts reagiert wurde. „Tobias Wilke: KI, DIE BOMBE. Zu Gegenwart und Geschichte einer Analogie“ weiterlesen
Magdalena Gronau/Martin Gronau: PHYSIKER IN DER (ALB-)TRAUMFABRIK. Christopher Nolans Oppenheimer
Oppenheimer (Regie: Christopher Nolan, USA 2023) hat diverse Rekorde gebrochen. Er zählt zu den erfolgreichsten Filmen mit R-Rating; schon jetzt konnte er sich unter den ganz oder in wesentlichen Teilen vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielenden Filmen den vordersten Platz sichern. Das 180 Minuten lange Biopic über den sogenannten ›Vater der Atombombe‹ stellt selbst langjährige Spitzenreiter wie Dunkirk (Regie: Christopher Nolan, USA 2017) oder Saving Private Ryan (Regie: Steven Spielberg, USA 1998) in den Schatten. Mit einem erlesenen Star-Ensemble und einem Budget von 100 Millionen US-Dollar hat Nolan ein dunkles Historienspektakel geschaffen, das angesichts revolutionärer KI-Entwicklungssprünge, menschengemachter Klimaveränderungen und wiederaufkeimender geopolitischer Bedrohungen erschreckend aktuell ist. Wieder einmal sieht sich die Menschheit mit ihren selbstzerstörerischen Kräften konfrontiert. „Magdalena Gronau/Martin Gronau: PHYSIKER IN DER (ALB-)TRAUMFABRIK. Christopher Nolans Oppenheimer“ weiterlesen
Hanna Hamel: SPIELE UND IHRE RÄUME
Beim Spielen kommt es offenbar aufs Maß an und auf die Umstände. Nicht oder nur schlecht spielen zu können gilt als Schwäche; umgekehrt erscheint es als riskant oder gefährlich, zu viel zu spielen, sich in Spielereien zu verlieren oder sogar ein falsches Spiel zu treiben. In der positiven Vorstellung des maßvollen, regelbewussten Spielens wirken bis heute Grundzüge anthropologischer Selbstbeschreibungen des 18. Jahrhunderts nach. In dieser Zeit rückte der Spielbegriff in den Fokus neuer ästhetischer Theorien, bevor er sich im 19. Jahrhundert als Gegenkonzept zu Ernst und Arbeit weiterentwickelte. Das Spiel wurde zum Aushandlungsort bürgerlichen Selbstverständnisses und gesellschaftlicher Regeln, zum Gegenstand von Theorie und Literatur.[1] „Hanna Hamel: SPIELE UND IHRE RÄUME“ weiterlesen
Barbara Picht: HANS JONAS IM RADIOINTERVIEW
Am 10. Mai 2023 jährt sich der Geburtstag des Philosophen Hans Jonas zum 120. Mal, der 5. Februar war sein 30. Todestag. Dies soll Anlass sein, auf ein Interview mit ihm hinzuweisen, das 1988 erstmals im Radio ausgestrahlt wurde und seit kurzem wieder zugänglich ist. Geführt wurde das Gespräch von dem Journalisten Harald von Troschke (1924–2009), der für die Aufzeichnung einen Besuch des aus den USA angereisten Hans Jonas’ in Heidelberg nutzte. Von Troschke war vielen Radiohörerinnen und -hörern durch seine rund einstündigen Porträtsendungen bekannt, die in den 1960er bis 1980er Jahren vom Norddeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk und weiteren Sendern im In- und Ausland ausgestrahlt wurden. Da von Troschke, unterstützt zunächst von seiner Frau, später auch von seinen drei Kindern, seine Beiträge selbst produzierte, behielt er die Rechte an den Sendungen. Seit 2020 kann sein Audionachlass deshalb im digitalen Harald von Troschke-Archiv präsentiert werden, wo sich auch das Interview mit Hans Jonas nachhören lässt.[1] „Barbara Picht: HANS JONAS IM RADIOINTERVIEW“ weiterlesen
Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS
Die Ausgabe Nr. 17 vom Oktober 2022 der chilenischen Kulturzeitschrift Papel Máquina ist der Arbeit der ehemaligen Direktorin des ZfL Sigrid Weigel gewidmet. Wir danken der Schriftstellerin Yoko Tawada für die Erlaubnis, ihren dort in spanischer Übersetzung erschienenen Beitrag im ZfL BLOG erstmals in der deutschen Originalfassung veröffentlichen zu dürfen.
Neulich nahm ich ein Buch von Sigrid Weigel in die Hand, das 1982 erschienen ist. Normalerweise bleiben alle Buchtitel auf einer Publikationsliste brav in einer chronologischen Reihe, und selbst wenn die Schlange sehr lang ist, was bei Weigel zweifellos der Fall ist, springt keiner von ihnen aus der Reihe und rennt nach vorne, in Richtung Zukunft. Aber es kommt doch vor, dass man, zum Beispiel bei einem Umzug, eines der Frühwerke in die Hand nimmt und darin blättert. Man wird überrascht von schillernden Denkbildern, die von heute sein könnten. Ansätze und Zusammenhänge, die man einer späteren Phase zugeordnet hätte, oder solche, die man jetzt erst begreift, stehen bereits in den älteren Büchern schwarz auf weiß. Gerade im digitalen Zeitalter, in dem die historischen Rahmen verschwimmen, gefällt mir die Unbestechlichkeit des Papiers, das die Zeit nie schleichend verfälscht. „Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS“ weiterlesen