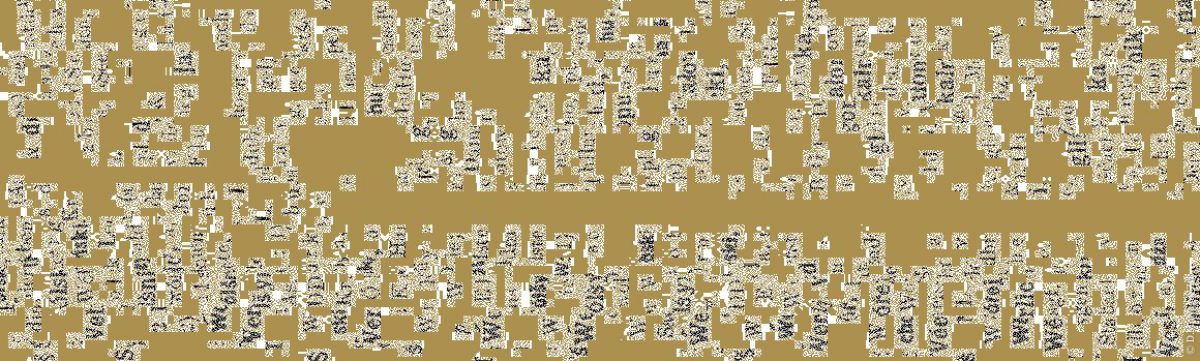»A.I. or Nuclear Weapons: Can You Tell These Quotes Apart?« – so fragte die New York Times ihre Leser:innen am 10. Juni dieses Jahres. In Form eines metadiskursiven Ratespiels rückte die Zeitung damit eine Analogie in den Blick, die in den jüngsten Debatten um Künstliche Intelligenz zu erheblicher Prominenz gelangt ist. Wenn derzeit die Risiken neuester (Sprach-)Technologien beschworen werden, lässt der Vergleich mit dem Vernichtungspotenzial von Atomwaffen nicht lange auf sich warten. Dies gilt für die in Print- und Onlinemedien ausgetragene Diskussion, ist aber auch innerhalb der wissenschaftlichen Community mit ihren Spezialöffentlichkeiten zu beobachten.[1] Warnungen vor den unabsehbaren Folgen der KI-Entwicklung gleichen in ihrer Drastik und teils bis aufs Wort den Mahnrufen und Appellen, mit denen in der Nachkriegszeit auf die damals neue Gefahr eines drohenden globalen Nuklearkonflikts reagiert wurde. „Tobias Wilke: KI, DIE BOMBE. Zu Gegenwart und Geschichte einer Analogie“ weiterlesen
Schlagwort: Künstliche Intelligenz
Hanna Hamel: SPIELE UND IHRE RÄUME
Beim Spielen kommt es offenbar aufs Maß an und auf die Umstände. Nicht oder nur schlecht spielen zu können gilt als Schwäche; umgekehrt erscheint es als riskant oder gefährlich, zu viel zu spielen, sich in Spielereien zu verlieren oder sogar ein falsches Spiel zu treiben. In der positiven Vorstellung des maßvollen, regelbewussten Spielens wirken bis heute Grundzüge anthropologischer Selbstbeschreibungen des 18. Jahrhunderts nach. In dieser Zeit rückte der Spielbegriff in den Fokus neuer ästhetischer Theorien, bevor er sich im 19. Jahrhundert als Gegenkonzept zu Ernst und Arbeit weiterentwickelte. Das Spiel wurde zum Aushandlungsort bürgerlichen Selbstverständnisses und gesellschaftlicher Regeln, zum Gegenstand von Theorie und Literatur.[1] „Hanna Hamel: SPIELE UND IHRE RÄUME“ weiterlesen
Orit Halpern / Robert Mitchell: RETHINKING SMARTNESS
Becoming a “smart city”
Like many metropolitan centers around the world, Berlin aspires to be a “smart city.” Making a city smart usually involves constructing a dense net of sensors, often embedded in and around more traditional infrastructures throughout the urban environment, such as transportation systems, electrical grids, and water systems. The process also requires the city to solicit the distributed input of its inhabitants through active technological means, such as smart phone apps. Finally, the city employs high-end computing and learning algorithms to analyze the resulting data, with the goal of optimizing urban technical, social, and political processes. Yet, perhaps counter-intuitively, a smart city is not synonymous with a utopian—or even a specific—form of the city, which would then remain stable for the foreseeable future. In this sense, the smart city is quite unlike utopian cities as they were imagined in the past, when it was presumed that a specific form—such as Le Corbusier’s “Radiant City” or the concentric circles of Ebenezer Howard’s garden cities—would enable a specific goal, such as integration of humans into natural processes, or economic growth, or an increase in collective happiness, or democratic political participation. Rather, a city is “smart” when it achieves the capacity to adjust to any new and unexpected threats and possibilities that may emerge from the city’s ecological, political, social, and economic environments (a capacity that is generally referred to in planning documents with the term “resilience”). In short, a smart city is a site of perpetual learning, and a city is smart when it achieves the capacity to engage in perpetual learning. „Orit Halpern / Robert Mitchell: RETHINKING SMARTNESS“ weiterlesen