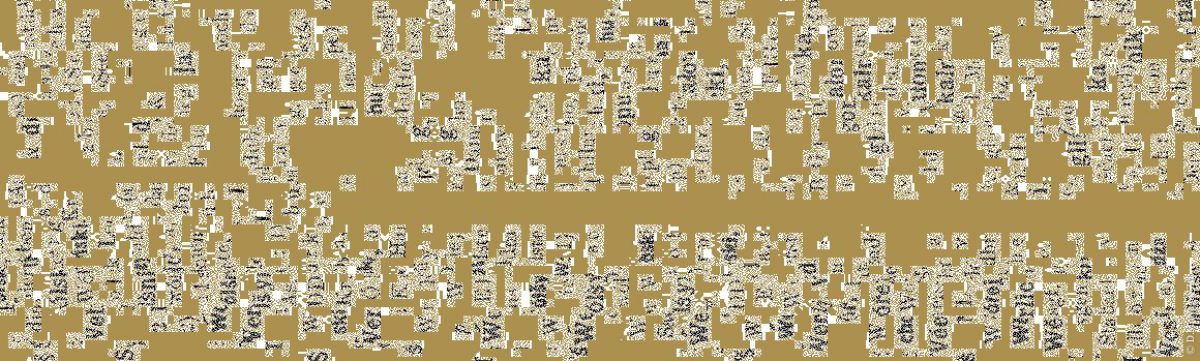»Erst der neue Zweck macht die neue Kunst«, erklärte Bertolt Brecht in seinem kurzen Essay Über Stoffe und Formen von 1929.[1] Formuliert als Begründung für die Entwicklung seiner Lehrstücke um 1930, liefert Brechts Äußerung einen Zugang zu den Debatten über den politischen Nutzen von Literatur nicht nur in der Zwischenkriegszeit, sondern auch in unserer Gegenwart. Obwohl die Äußerung den Anschein eines unerschütterlichen künstlerischen Dogmas hat, verbleibt sie in einer ambivalenten Schwebe zwischen zwei scheinbar konträren Positionen in Bezug auf die eigentlichen Verpflichtungen engagierter Kunst. Einerseits scheint Brechts Satz auf dem absoluten Vorrang des politischen Engagements vor ästhetischen Belangen zu bestehen, indem er suggeriert, dass die inneren Funktionsweisen der Literatur notwendigerweise einem äußeren (d.h. politischen oder gesellschaftlichen) Zweck untergeordnet sind; andererseits behauptet er, dass Politik für den Künstler nur insofern von Wert ist, als sie eine radikale Umgestaltung der Muster und Formen der Kunst ermöglicht. Anders ausgedrückt: Künstlerische Innovationen scheinen ohne eine vorherige Verpflichtung auf (politische oder gesellschaftliche) Zwecke, die als außerhalb der Kunst liegend vorgestellt werden, undenkbar zu sein. Doch gleichzeitig muss, was die Arbeit des Schriftstellers betrifft, der Wert dieser ›vorherigen‹ Verpflichtungen an ihrem Vermögen gemessen werden, neue ästhetische Formen hervorzubringen. Brecht zufolge birgt die Frage nach den Verpflichtungen der Kunst eine unauflösbare Dialektik: Kunst und politischer Zweck sind einander nicht äußerlich, ihre Beziehung ist nicht durch Konflikt oder gegenseitigen Ausschluss gekennzeichnet, sondern vielmehr durch das Versprechen schöpferischer Reibung und gegenseitiger Bereicherung. „Benjamin Kohlmann/Ivana Perica: DER POLITISCHE GEBRAUCH UND NUTZEN VON LITERATUR“ weiterlesen
Schlagwort: Theoriegeschichte
Henning Trüper: AKTIVISMUS UND KULTURGESCHICHTE DES MORALISCHEN
›Aktivismus‹ wird heute kontextabhängig in vielen Bedeutungen verwendet: als deskriptive Bestimmung, positiver Identifikationsbegriff, Begriff der polemischen Abwertung oder Zielscheibe jargonkritischen Spotts.[1] Im Kern des Begriffs behauptet sich aber stets die individuelle Partizipation am kollektiven gesellschaftlichen Handeln, insbesondere an der Politik. Meist wird als Aktivismus die emphatische Teilnahme an sozialen Bewegungen emanzipatorischer Art bezeichnet. Es geht dabei häufig um marginalisierte Gruppen und Anliegen. Forderungen nach Ermächtigung und Gleichberechtigung sowie die Herausstellung besonderer Schutzbedürftigkeit stehen im Zentrum. Auch im aktivistischen Umgang mit dem Klimawandel bleibt der Grundgedanke des Schutzes – nun nicht mehr nur menschlicher Akteure, sondern einer ihrer Rechte beraubten Natur – erkennbar. „Henning Trüper: AKTIVISMUS UND KULTURGESCHICHTE DES MORALISCHEN“ weiterlesen
Tobias Wilke: KI, DIE BOMBE. Zu Gegenwart und Geschichte einer Analogie
»A.I. or Nuclear Weapons: Can You Tell These Quotes Apart?« – so fragte die New York Times ihre Leser:innen am 10. Juni dieses Jahres. In Form eines metadiskursiven Ratespiels rückte die Zeitung damit eine Analogie in den Blick, die in den jüngsten Debatten um Künstliche Intelligenz zu erheblicher Prominenz gelangt ist. Wenn derzeit die Risiken neuester (Sprach-)Technologien beschworen werden, lässt der Vergleich mit dem Vernichtungspotenzial von Atomwaffen nicht lange auf sich warten. Dies gilt für die in Print- und Onlinemedien ausgetragene Diskussion, ist aber auch innerhalb der wissenschaftlichen Community mit ihren Spezialöffentlichkeiten zu beobachten.[1] Warnungen vor den unabsehbaren Folgen der KI-Entwicklung gleichen in ihrer Drastik und teils bis aufs Wort den Mahnrufen und Appellen, mit denen in der Nachkriegszeit auf die damals neue Gefahr eines drohenden globalen Nuklearkonflikts reagiert wurde. „Tobias Wilke: KI, DIE BOMBE. Zu Gegenwart und Geschichte einer Analogie“ weiterlesen
Oliver Precht: AUCH EINE GESCHICHTE DER THEORIE
 »Das Folgende«, stellt Morten Paul gleich zu Beginn seiner Studie über Suhrkamps (mehr oder weniger) graue Bände klar, »ist keine Geschichte der Theorie, sondern eine Geschichte der Theorie-Reihe« (Morten Paul: Suhrkamp Theorie. Eine Buchreihe im philosophischen Nachkrieg, Leipzig: Spector Books 2023, 18). Vielleicht hatte er beim Verfassen dieses Warnhinweises noch den Vorwurf im Ohr, den Gerhard Poppenberg in seinem Essay Herbst der Theorie an Philipp Felschs viel gelesenes Buch Der lange Sommer der Theorie gerichtet hat: Felsch verenge die komplexe, an eine Vielzahl von Orten, Institutionen, Produktions- und Rezeptionsmilieus gebundene Theoriegeschichte auf die spezifischen von ihm untersuchten Kontexte, nämlich auf »die Verlage Suhrkamp und Merve, die Berliner FU und die Subkultur der Siebziger- und Achtzigerjahre«.[1] Hinter diesem etwas wohlfeilen Vorwurf steht eine Vorstellung von Theoriegeschichte, die sich keineswegs von selbst versteht. „Oliver Precht: AUCH EINE GESCHICHTE DER THEORIE“ weiterlesen
»Das Folgende«, stellt Morten Paul gleich zu Beginn seiner Studie über Suhrkamps (mehr oder weniger) graue Bände klar, »ist keine Geschichte der Theorie, sondern eine Geschichte der Theorie-Reihe« (Morten Paul: Suhrkamp Theorie. Eine Buchreihe im philosophischen Nachkrieg, Leipzig: Spector Books 2023, 18). Vielleicht hatte er beim Verfassen dieses Warnhinweises noch den Vorwurf im Ohr, den Gerhard Poppenberg in seinem Essay Herbst der Theorie an Philipp Felschs viel gelesenes Buch Der lange Sommer der Theorie gerichtet hat: Felsch verenge die komplexe, an eine Vielzahl von Orten, Institutionen, Produktions- und Rezeptionsmilieus gebundene Theoriegeschichte auf die spezifischen von ihm untersuchten Kontexte, nämlich auf »die Verlage Suhrkamp und Merve, die Berliner FU und die Subkultur der Siebziger- und Achtzigerjahre«.[1] Hinter diesem etwas wohlfeilen Vorwurf steht eine Vorstellung von Theoriegeschichte, die sich keineswegs von selbst versteht. „Oliver Precht: AUCH EINE GESCHICHTE DER THEORIE“ weiterlesen
Barbara Picht: HANS JONAS IM RADIOINTERVIEW
Am 10. Mai 2023 jährt sich der Geburtstag des Philosophen Hans Jonas zum 120. Mal, der 5. Februar war sein 30. Todestag. Dies soll Anlass sein, auf ein Interview mit ihm hinzuweisen, das 1988 erstmals im Radio ausgestrahlt wurde und seit kurzem wieder zugänglich ist. Geführt wurde das Gespräch von dem Journalisten Harald von Troschke (1924–2009), der für die Aufzeichnung einen Besuch des aus den USA angereisten Hans Jonas’ in Heidelberg nutzte. Von Troschke war vielen Radiohörerinnen und -hörern durch seine rund einstündigen Porträtsendungen bekannt, die in den 1960er bis 1980er Jahren vom Norddeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk und weiteren Sendern im In- und Ausland ausgestrahlt wurden. Da von Troschke, unterstützt zunächst von seiner Frau, später auch von seinen drei Kindern, seine Beiträge selbst produzierte, behielt er die Rechte an den Sendungen. Seit 2020 kann sein Audionachlass deshalb im digitalen Harald von Troschke-Archiv präsentiert werden, wo sich auch das Interview mit Hans Jonas nachhören lässt.[1] „Barbara Picht: HANS JONAS IM RADIOINTERVIEW“ weiterlesen
Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS
Die Ausgabe Nr. 17 vom Oktober 2022 der chilenischen Kulturzeitschrift Papel Máquina ist der Arbeit der ehemaligen Direktorin des ZfL Sigrid Weigel gewidmet. Wir danken der Schriftstellerin Yoko Tawada für die Erlaubnis, ihren dort in spanischer Übersetzung erschienenen Beitrag im ZfL BLOG erstmals in der deutschen Originalfassung veröffentlichen zu dürfen.
Neulich nahm ich ein Buch von Sigrid Weigel in die Hand, das 1982 erschienen ist. Normalerweise bleiben alle Buchtitel auf einer Publikationsliste brav in einer chronologischen Reihe, und selbst wenn die Schlange sehr lang ist, was bei Weigel zweifellos der Fall ist, springt keiner von ihnen aus der Reihe und rennt nach vorne, in Richtung Zukunft. Aber es kommt doch vor, dass man, zum Beispiel bei einem Umzug, eines der Frühwerke in die Hand nimmt und darin blättert. Man wird überrascht von schillernden Denkbildern, die von heute sein könnten. Ansätze und Zusammenhänge, die man einer späteren Phase zugeordnet hätte, oder solche, die man jetzt erst begreift, stehen bereits in den älteren Büchern schwarz auf weiß. Gerade im digitalen Zeitalter, in dem die historischen Rahmen verschwimmen, gefällt mir die Unbestechlichkeit des Papiers, das die Zeit nie schleichend verfälscht. „Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS“ weiterlesen
Kirk Wetters: The Short Spring of German Theory (II): WE HAVE ALWAYS BEEN POSTCRITICAL
Theory, Critique, Critical Theory
In the retrospect of almost a decade, the year 2015 seems to offer at least two openings which can help us better understand and localize the “end of theory” narratives that began to take hold sometime around the end of the millennium. Rita Felski’s much-discussed and much-maligned 2015 book, The Limits of Critique, construed the long history of “critique” as largely continuous with the more recent (postwar) idea of “theory,” which allowed her to question the presupposed progressivity and utility of the dominant critical-theoretical discourses of late 20th-century North American academia. In the same year, Philipp Felsch’s Der lange Sommer der Theorie (which was recently published in English as The Summer of Theory) went so far as to assign specific dates, 1960–1990, and tended to define theory not as a purely academic product, but as a much wider cultural movement.[1] Between the two books, questions of the difference between theory and critique, their specific institutional locus within and beyond academia, became objects of acute concern. „Kirk Wetters: The Short Spring of German Theory (II): WE HAVE ALWAYS BEEN POSTCRITICAL“ weiterlesen
Kirk Wetters: The Short Spring of German Theory (I): POSITIVISMUSSTREIT VS. POETIK UND HERMENEUTIK
Transatlantic Theory Canons
In present-day Germany, research on postwar academia, up through the 1960s and beyond, requires no special justification. But from the North American side, the point of this scholarly activity—including the many new editions and a flood of archive-based publications—is much less obvious. For the most well-established figures of the period, the primary international canonizations were already part of the first waves of the reception, the theoretical tectonics established themselves accordingly, and the theories were established as theories—which are in many quarters presumed to be just as reliable today as they were decades ago. One might say that the international and North American reception of European theory has manifested an overall tendency toward sedimentation, while the dynamic of scholarly research about theory, including the archival unearthing of new sources, tends to complicate and undermine the established corpus of “primary texts.” For example, not only does the quantity of new German publications on (and by) figures like Hans Blumenberg or Siegfried Kracauer widen the rift and amplify the asynchrony between North American and German academic cultures, it also heightens awareness for the fact that these somewhat “second tier” figures were extremely important all along. „Kirk Wetters: The Short Spring of German Theory (I): POSITIVISMUSSTREIT VS. POETIK UND HERMENEUTIK“ weiterlesen
Eva Stubenrauch: DIE KRISE DER ZEITDIAGNOSTIK. Reckwitz, Rosa und die Gesellschaftstheorie der Gegenwart
Die Gegenwart wurde in den vergangenen Jahrzehnten so oft diagnostiziert wie nie zuvor. Seit den 1980er Jahren, angefangen bei Ulrich Becks ›Risikogesellschaft‹, häufen sich entsprechende Zuschreibungen:[1] ›Erlebnisgesellschaft‹, ›Informationsgesellschaft‹, ›Postdemokratie‹, ›breite Gegenwart‹, ›Retrotopia‹ und dergleichen mehr. Wie der Begriff und die in ihm angelegte medizinische Semantik schon andeuten, geht mit der Zeitdiagnostik immer eine Kritik an der Gegenwart einher. „Eva Stubenrauch: DIE KRISE DER ZEITDIAGNOSTIK. Reckwitz, Rosa und die Gesellschaftstheorie der Gegenwart“ weiterlesen
Oliver Precht: GIBT ES EINE »BRAZILIAN THEORY«?
Leicht lässt sich das Nachträgliche und Artifizielle an Konstruktionen wie French Theory (oder in jüngerer Zeit auch Italian Theory)[1] herausstellen: Sie unterstellen eine Einheit, wo es keine gibt, scheren Theoretiker*innen verschiedenster Hintergründe und mit unterschiedlichsten Interessen über einen Kamm.[2] Dennoch bietet die Rede von einer French Theory – im Gegensatz zu den ebenfalls außerhalb von Frankreich entstandenen und popularisierten Sammelbegriffen Poststrukturalismus oder Postmoderne – einige Vorteile. Sie verpflichtet die disparaten Theorien erstens nicht auf ein gemeinsames Programm und verweist zweitens darauf, dass die Produktion von Theorie an einem bestimmten Ort geschieht, in diesem Fall im Frankreich der 1960er und 1970er Jahre, und ihre Entstehung an einen gesellschaftlich-politischen Kontext sowie an institutionelle Rahmenbedingungen gebunden ist. In jüngerer Vergangenheit drängt sich zunehmend die Frage nach einer möglichen Brazilian Theory auf. Bereits 2014 erschien in Deutschland, allerdings in englischer Sprache, unter dem Titel The Forest and the School eine erste Anthologie.[3] In den folgenden Jahren nahm das Interesse an Theorie aus (und über) Brasilien spürbar zu, was sich nicht zuletzt in einer Reihe von Übersetzungen niederschlug.[4] Als Timo Luks diese Entwicklung 2020 unter dem Titel »Brasilianische Interventionen« im Merkur reflektierte, konnte er bereits feststellen: »Brasilen ist Gegenstand unseres Nachdenkens und Provokation für unser Denken«.[5] Selbst von einer sich andeutenden »Brasilianisierung der Theorie« ist hier die Rede. „Oliver Precht: GIBT ES EINE »BRAZILIAN THEORY«?“ weiterlesen