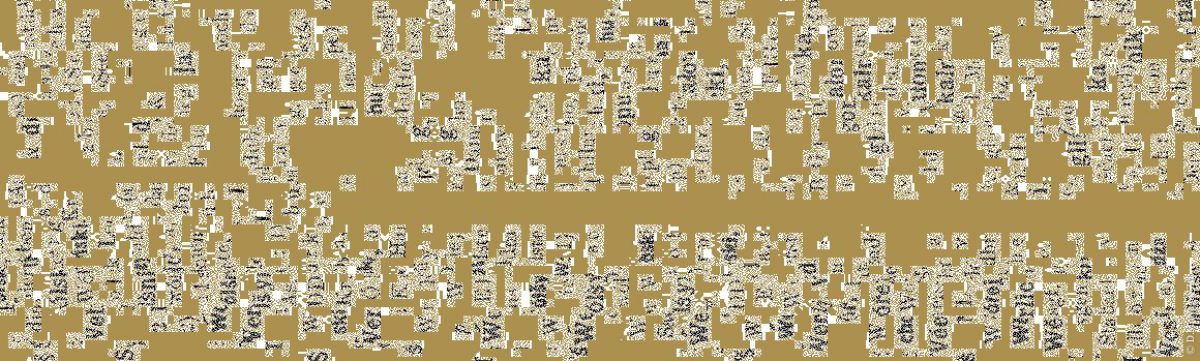Vor gut zehn Jahren rückte der NSU-Komplex ins Licht einer ahnungslosen Öffentlichkeit. Mit jedem neuen Detail der Mordserie, die bis zu diesem Punkt in den hinteren Mediensegmenten ein belangloses Dasein als ›Dönermorde‹ fristete, sandte eine Terrororganisation, die sich Nationalsozialistischer Untergrund nannte und die Morde nun öffentlich für sich reklamierte, nachträglich Schockwellen ins öffentliche Bewusstsein. Als Antwort auf den Terror, der sich direkt vor ihren Augen und doch jenseits ihrer Aufmerksamkeit abgespielt hatte, eröffnete die Gesellschaft, vertreten durch die Bundesanwaltschaft, dann am 6. Mai 2013 einen Prozess. Den Strafprozess als jenes öffentliche Verfahren, das die Ausübung legaler Gerechtigkeit verspricht – Gerechtigkeit durch Prozess und Gesetz –, nennt die amerikanische Literaturtheoretikerin Shoshana Felman »die angemessenste und wesentlichste, letztlich bedeutsamste Antwort der Zivilisation auf die Gewalt, die sie verwundet«.[1] Das Verfahren dieser Antwort verfolgt aber nun einen dezidiert eigenen Zweck, mit einem durchaus anderen Fokus als dem der gesellschaftlichen Aufarbeitung. Die Spannung zwischen dem innerrechtlichen Ziel einerseits – der Feststellung individueller Schuld – und dem gesellschaftlichen Bedarf an Aufarbeitung andererseits durchzieht den gesamten NSU-Prozess und prägt nicht zuletzt die Art, wie der gesamte NSU-Komplex dabei in Erscheinung und auf die Bühne der Welt tritt. „Katrin Trüstedt: PROZESS DES ERSCHEINENS. Vom Rande des NSU-Verfahrens“ weiterlesen
Schlagwort: Theoriegeschichte
Anna Förster: THEORIE – ÜBERSETZUNG – GESCHICHTE
Sammelbände zu rezensieren ist eine notorisch schwierige Angelegenheit. Dies liegt – vor allem anderen – an ihrer programmatischen Heterogenität. Häufig wird vollkommen Disparates mit hohem argumentativem Einsatz zusammengespannt und unter das Dach einer im Grunde nicht ein- sondern lediglich zugeschriebenen Leitfrage gezwungen. Sehr viel seltener ist hingegen, dass Vielfalt und Unterschiedlichkeit seiner Zugänge, Standpunkte und Argumente dem Sammelband nicht zum Nachteil gereichen, sondern, im Gegenteil, sich mimetisch zur Unabgeschlossenheit einer aktuellen Diskussion verhalten. Genau so verhält es sich erfreulicherweise im Falle des von Wolfgang Hottner herausgegebenen Sammelbands Deutsch-französischer und transatlantischer Theorietransfer im 20. Jahrhundert (Stuttgart: J.B. Metzler, 2020). Denn die Diskussion über die Frage, welche Rolle Übersetzungsprozesse für die Theoriegeschichte spielen und welchen Stellenwert ihnen die Theoriegeschichtsschreibung einzuräumen habe, wird – von wenigen Ausnahmen abgesehen[1] – zumindest hierzulande erst seit Kurzem ernsthaft geführt. „Anna Förster: THEORIE – ÜBERSETZUNG – GESCHICHTE“ weiterlesen
Oliver Precht: PORTRAIT OF A PHILOSOPHER (Notes on a New Biography of Jacques Derrida)
Writing a biography of Jacques Derrida is no small task. The biographer is not only confronted with an abundance of personal material, he or she must also confront Derrida’s extensive and notoriously complex oeuvre. Matters become even more complicated when considering the author’s autobiographical writings and his almost obsessive attempt to create his own archive. In the early years of his career, Derrida was extremely reluctant to disclose any biographical information, but once he had revealed the first details on his personal life in a 1983 interview with Catherine David for Le Nouvel Observateur, Derrida intensified his attempts to narrate and thereby control his biography. This biographical turn resulted not only in some of his best known texts,[1] but also in the donation of his personal archive to the Langson Library at the University of California, Irvine, and the Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), close to Caen. However, as Peter Salmon notes (Peter Salmon, An Event, Perhaps. A Biography of Jacques Derrida, London / New York: Verso, 2020), this self-archivisation and self-narration does „not simply record, it produces. By selecting what is important, it rejects what is not” (270). The same is true of Salmon’s book: it “adds another narrative version of the life of Jacques Derrida” (ibid.). „Oliver Precht: PORTRAIT OF A PHILOSOPHER (Notes on a New Biography of Jacques Derrida)“ weiterlesen
Georg Dickmann: »Zu zweit schreiben ist ein Witz, ein gewolltes Missverständnis«. ZU ARMEN AVANESSIANS UND ANKE HENNIGS KOLLABORATIVER POETIK
»Schreiben im Werden«, wie es Gilles Deleuze im Dialog mit Claire Parnet definiert hat, ist eine Form radikaler Entgrenzung und Öffnung auf ein neues Schreiben hin, das sich gegen die Einschränkungen linearer Narrative und eines mit sich selbst identischen Schriftsteller*innenbegriffs richtet.[1] Wie wir wissen, haben Deleuze & Guattari lange Jahre versucht, dieses gemeinsame Schreiben im Werden zu praktizieren. Das große Versprechen eines solchen Schreibens zu zweit lag darin, ein flexibles, nomadisches Subjekt hervortreten lassen, das nicht an Gattungs- und Genregrenzen gebunden ist. Die Hoffnungen, damit ein neues Schreiben zu verwirklichen, haben sich jedoch nicht erfüllt, da das Werden und die Vielstimmigkeit in den gemeinsam geschriebenen Büchern letztlich hinter einem souveränen und mit sich selbst identischen Autorensubjekt verschwanden. Insbesondere die postmodernen Erwartungen an subversive Praktiken wie Wandlungsfähigkeit und Flexibilität sind heute von der neoliberalen Maschine verstanden und absorbiert worden. An den Universitäten sind Kreativität und Flexibilität schon längst zu gefragten Soft Skills avanciert. „Georg Dickmann: »Zu zweit schreiben ist ein Witz, ein gewolltes Missverständnis«. ZU ARMEN AVANESSIANS UND ANKE HENNIGS KOLLABORATIVER POETIK“ weiterlesen
Rabea Kleymann: ÜBER DAS ERZÄHLWÜRDIGE DER THEORIE IN DEN DIGITAL HUMANITIES
Unter dem Label »Digital Humanities« (DH) werden unterschiedliche Themen, Gegenstände und Erkenntnisansprüche subsumiert. Vielen gelten die DH als Erweiterung des klassischen Methodenkanons, da sie computergestützte Verfahren für die Geisteswissenschaften in Aussicht stellen. Gleichzeitig verstärken die DH, indem sie unter anderem neue Werkzeuge anbieten, auch praxeologische Tendenzen innerhalb der Geisteswissenschaften. Infolgedessen haben sich die Rede von der Theorielosigkeit der DH sowie Erzählungen vom »Ende der Theorie«[1] in den Diskussionen über digitale Methoden, Praktiken und Forschungsinfrastrukturen als Hauptnarrative etabliert. Dem Status der Theorie in den DH widmete sich die Tagung Theorytellings: Wissenschaftsnarrative in den Digital Humanities, die am 8. und 9. Oktober 2020 in Leipzig stattfand und von der Arbeitsgruppe »Digital Humanities Theorie« des Verbandes »Digital Humanities im deutschsprachigen Raum« und dem »Forum für Digital Humanities Leipzig« organisiert wurde. „Rabea Kleymann: ÜBER DAS ERZÄHLWÜRDIGE DER THEORIE IN DEN DIGITAL HUMANITIES“ weiterlesen
Moritz Neuffer: PREKÄRE THEORIE, oder: Wer ist Hildegard Brenner?
»What makes a great magazine editor?«, fragte der britische Literaturwissenschaftler Matthew Philpotts kürzlich in einem Essay für Eurozine und stellte eine Typologie von Herausgebertypen auf, die in der Intellektuellengeschichte des 20. Jahrhunderts bedeutende Rollen spielten. In dieser Typologie finden sich charismatische und ›performative‹ Leitfiguren wie Herwarth Walden (Der Sturm) oder Karl Kraus (Die Fackel), nüchterne und bescheidene Verwalter wie Carl von Ossietzky (Die Weltbühne) oder Herbert Steiner (Corona), aber auch Jongleure zwischen diesen Extremen wie Peter Suhrkamp (Neue Rundschau) oder Jean Paulhan (Nouvelle Revue Française). Der einzelgängerische Criterion-Herausgeber T.S. Eliot wird dem ›kollektiven‹ Stil von Sartres Les Temps Modernes gegenübergestellt, während Thomas Mann als Co-Herausgeber von Mass und Wert wiederum dazwischen steht. Der Kanon der ›großen‹ verlegenden Männer legt den Gedanken nahe, dass Hildegard Brenner (*1927) in der intellektuellen Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung darstellte. „Moritz Neuffer: PREKÄRE THEORIE, oder: Wer ist Hildegard Brenner?“ weiterlesen
Zaal Andronikashvili: PHILOSOPHIE ALS SCHÖPFERISCHER AKT. Zum 30. Todestag Merab Mamardaschwilis
Merab Mamardaschwili (1930–1990) ist ein, wenn nicht der bedeutendste Philosoph aus der Sowjetunion. Der »georgische Sokrates« (Jean-Pierre Vernant) genießt in seiner georgischen Heimat und in Russland, wo er mehrere Generationen von Philosoph*innen beeinflusst hat, beinahe kultische Verehrung. Mamardaschwilis Philosophie aber wurde von seinem Kultstatus geradezu erdrückt: Er ist als philosophische Pop-Ikone in Georgien und Russland allgegenwärtig, er wird bewundert, passend oder unpassend zitiert, aber wenig gelesen. Außerhalb der ehemaligen Sowjetunion ist er weitgehend unbekannt geblieben, in deutscher Übersetzung liegen nur einzelne Vorträge und Aufsätze vor. 30 Jahre nach seinem Tod am 25. November 1990 wäre es die beste Würdigung, ihn von seinem Denkmalstatus zu befreien und als einen Philosophen wiederzuentdecken, mit dem die Fragen an die Gegenwart anders zu stellen und möglicherweise auch zu beantworten sind.[1] „Zaal Andronikashvili: PHILOSOPHIE ALS SCHÖPFERISCHER AKT. Zum 30. Todestag Merab Mamardaschwilis“ weiterlesen
Eva Geulen: ALTES UND NEUES AUS DEN LITERATURWISSENSCHAFTEN
Zwei Herren stritten sich jüngst gepflegt. Meister ihres Fachs (der Romanistik) alle beide, ging es einmal mehr um Herkunft und Zukunft der Geistes- und vor allem der Literaturwissenschaften. Den Aufschlag machte Hans Ulrich Gumbrecht in der NZZ vom 29. Oktober 2019. Der Bestandsaufnahme (sinkende Hörerzahlen, falsch verstandene Professionalisierung und moralisch überformte politische Korrektheit) folgte die Geschichtslektion: Die große Zeit der Geisteswissenschaften lag in dem Jahrhundert zwischen Romantik und Erstem Weltkrieg. Danach ging es etappenweise bergab, mit verzweifelter, auch vor schlimmsten Ideologien nicht Halt machender Anbiederung an die sogenannte Öffentlichkeit; aber auch Rückzug in den Elfenbeinturm und zunehmende Verwissenschaftlichung trugen zur Selbstzerstörung der Geisteswissenschaften bei. „Eva Geulen: ALTES UND NEUES AUS DEN LITERATURWISSENSCHAFTEN“ weiterlesen
Eva Geulen / Claude Haas: HÖLDERLIN UND HEGEL HEUTE
Freundschafft
Wenn Menschen sich aus innrem Werthe kennen,
So können sie sich freudig Freunde nennen,
Das Leben ist den Menschen so bekannter,
Sie finden es im Geist interessanter.Der hohe Geist ist nicht der Freundschafft ferne,
Die Menschen sind den Harmonien gerne
Und der Vertrautheit hold, daß sie der Bildung leben,
Auch dieses ist der Menschheit so gegeben. „Eva Geulen / Claude Haas: HÖLDERLIN UND HEGEL HEUTE“ weiterlesen
Ross Shields: READING THE AESTHETICS OF RESISTANCE
The Aesthetics of Resistance. Already the title demands interpretation. Depending on whether the preposition ‘of’ is interpreted as a subjective or as an objective genitive, it could refer either to ‘the aesthetic position upheld by those fighting for the resistance’ or to ‘the aesthetic aspect of resistance as such.’ As one might expect, Peter Weiss’s novel supports both readings, insofar as it concerns a group of resistance fighters who conceive of art—whether ancient, aristocratic, bourgeois, or proletarian—as closely related to their own political activity: “If we want to take on art, literature, we have to treat them against the grain, that is, we have to eliminate all the concomitant privileges and project our own demands into them.”[1] The aesthetic position of those fighting in the resistance is that art is eminently political. But the first person plural is misleading, and introduces an additional ambiguity concerning the novel’s message: does “we” stand for the unnamed narrator and his comrades in the 1930’s, for Weiss’s milieu in the 1970s, or for the international readership of the perpetually advancing present? „Ross Shields: READING THE AESTHETICS OF RESISTANCE“ weiterlesen