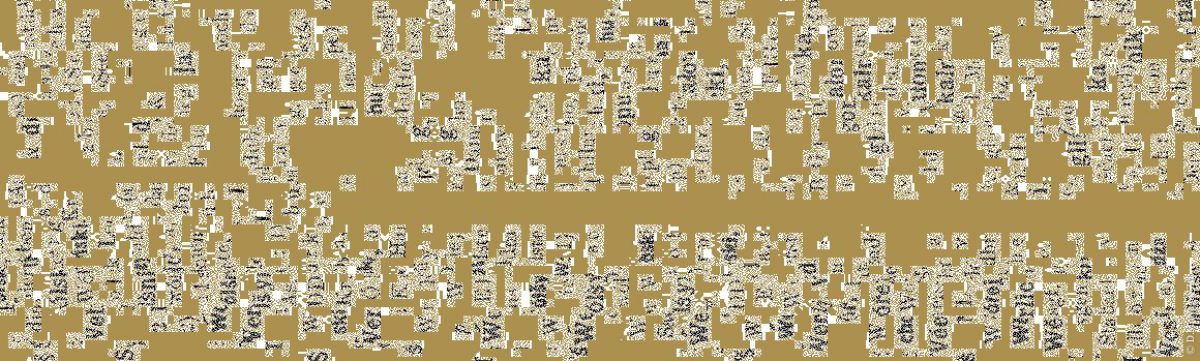In der Geschichte moderner Gesellschaften sind Zeitschriften und Öffentlichkeit so eng aufeinander bezogen, dass sie nahezu synonym erscheinen. Schließlich soll Öffentlichkeit derjenige Raum sein, in dem freie Menschen sich als Gleiche begegnen und über Belange kommunizieren, die von allgemeinem Interesse sind. In Gemeinwesen, in denen gesellschaftliche Auseinandersetzung und Selbstvergewisserung nicht durch unmittelbaren Kontakt garantiert sind, helfen Zeitschriften dabei, Öffentlichkeit – oder ausdifferenzierte Teilöffentlichkeiten – herzustellen. Sie tun dies, indem sie Texte und Bilder, Gattungen und Disziplinen, Stimmen und Stimmungen versammeln und bündeln, und indem sie in mal mehr, mal weniger regelmäßiger Folge öffentlichen Austausch auf Dauer stellen. „Moritz Neuffer/Morten Paul: Periodische Formgebung. ZEITSCHRIFTEN UND ÖFFENTLICHKEIT IN DER FRÜHEN BUNDESREPUBLIK“ weiterlesen
Schlagwort: Intellektuellengeschichte
Moritz Neuffer: PREKÄRE THEORIE, oder: Wer ist Hildegard Brenner?
»What makes a great magazine editor?«, fragte der britische Literaturwissenschaftler Matthew Philpotts kürzlich in einem Essay für Eurozine und stellte eine Typologie von Herausgebertypen auf, die in der Intellektuellengeschichte des 20. Jahrhunderts bedeutende Rollen spielten. In dieser Typologie finden sich charismatische und ›performative‹ Leitfiguren wie Herwarth Walden (Der Sturm) oder Karl Kraus (Die Fackel), nüchterne und bescheidene Verwalter wie Carl von Ossietzky (Die Weltbühne) oder Herbert Steiner (Corona), aber auch Jongleure zwischen diesen Extremen wie Peter Suhrkamp (Neue Rundschau) oder Jean Paulhan (Nouvelle Revue Française). Der einzelgängerische Criterion-Herausgeber T.S. Eliot wird dem ›kollektiven‹ Stil von Sartres Les Temps Modernes gegenübergestellt, während Thomas Mann als Co-Herausgeber von Mass und Wert wiederum dazwischen steht. Der Kanon der ›großen‹ verlegenden Männer legt den Gedanken nahe, dass Hildegard Brenner (*1927) in der intellektuellen Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung darstellte. „Moritz Neuffer: PREKÄRE THEORIE, oder: Wer ist Hildegard Brenner?“ weiterlesen
Patrick Eiden-Offe/Moritz Neuffer: WAS IST UND WAS WILL KULTURWISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFTENFORSCHUNG?
Inmitten der verheerenden Weltwirtschaftskrise fassten Walter Benjamin und Bertolt Brecht 1929/30 den Plan, eine Zeitschrift zu gründen. Sie sollte Krisis und Kritik heißen und sich nicht nur der »Krise auf allen Gebieten der Ideologie« annehmen, sondern selbst, mit den Mitteln der Kritik, Krise produzieren: »Aufgabe der Zeitschrift ist es, diese Krise festzustellen oder herbeizuführen«, schrieb Benjamin an seinen Freund Brecht.[1] Ihr reger Austausch über potentielle Themen, Schreibweisen und Beitragende offenbart, dass Benjamin und Brecht nicht nur die Inhalte, sondern auch die sozialen und operativen Dimensionen ihres – letztlich niemals realisierten – Projektes im Blick hatten. Krisis und Kritik, so ihre Überzeugung, würde »die bisher leere Stelle eines Organs einnehmen, in dem die bürgerliche Intelligenz sich Rechenschaft von den Forderungen und den Einsichten gibt, die einzig und allein ihr unter den heutigen Umständen eine eingreifende, von Folgen begleitete Produktion im Gegensatz zu der üblichen willkürlichen und folgenlosen gestatten«.[2]