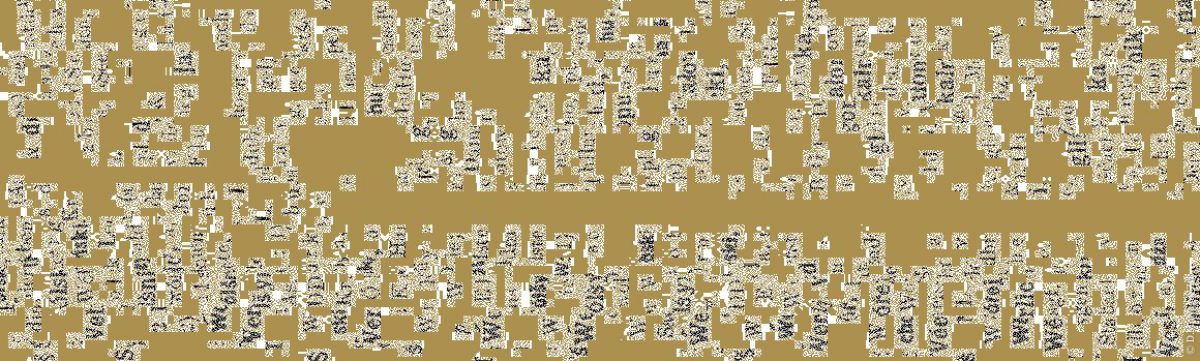›Aktivismus‹ wird heute kontextabhängig in vielen Bedeutungen verwendet: als deskriptive Bestimmung, positiver Identifikationsbegriff, Begriff der polemischen Abwertung oder Zielscheibe jargonkritischen Spotts.[1] Im Kern des Begriffs behauptet sich aber stets die individuelle Partizipation am kollektiven gesellschaftlichen Handeln, insbesondere an der Politik. Meist wird als Aktivismus die emphatische Teilnahme an sozialen Bewegungen emanzipatorischer Art bezeichnet. Es geht dabei häufig um marginalisierte Gruppen und Anliegen. Forderungen nach Ermächtigung und Gleichberechtigung sowie die Herausstellung besonderer Schutzbedürftigkeit stehen im Zentrum. Auch im aktivistischen Umgang mit dem Klimawandel bleibt der Grundgedanke des Schutzes – nun nicht mehr nur menschlicher Akteure, sondern einer ihrer Rechte beraubten Natur – erkennbar. „Henning Trüper: AKTIVISMUS UND KULTURGESCHICHTE DES MORALISCHEN“ weiterlesen
Schlagwort: Lebenswissen
Magdalena Gronau/Martin Gronau: PHYSIKER IN DER (ALB-)TRAUMFABRIK. Christopher Nolans Oppenheimer
Oppenheimer (Regie: Christopher Nolan, USA 2023) hat diverse Rekorde gebrochen. Er zählt zu den erfolgreichsten Filmen mit R-Rating; schon jetzt konnte er sich unter den ganz oder in wesentlichen Teilen vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielenden Filmen den vordersten Platz sichern. Das 180 Minuten lange Biopic über den sogenannten ›Vater der Atombombe‹ stellt selbst langjährige Spitzenreiter wie Dunkirk (Regie: Christopher Nolan, USA 2017) oder Saving Private Ryan (Regie: Steven Spielberg, USA 1998) in den Schatten. Mit einem erlesenen Star-Ensemble und einem Budget von 100 Millionen US-Dollar hat Nolan ein dunkles Historienspektakel geschaffen, das angesichts revolutionärer KI-Entwicklungssprünge, menschengemachter Klimaveränderungen und wiederaufkeimender geopolitischer Bedrohungen erschreckend aktuell ist. Wieder einmal sieht sich die Menschheit mit ihren selbstzerstörerischen Kräften konfrontiert. „Magdalena Gronau/Martin Gronau: PHYSIKER IN DER (ALB-)TRAUMFABRIK. Christopher Nolans Oppenheimer“ weiterlesen
Pola Groß: KINDER KRIEGEN. KINDER HABEN. Zu zwei Neuerscheinungen
Kinderbetreuung, Hausarbeit und Pflege älterer Menschen gehören nicht zu den Tätigkeiten, die in der Literatur bislang viel Raum eingenommen haben.[1] Seit einiger Zeit ändert sich das und es erscheinen zunehmend Texte, die Sorgearbeit ins Zentrum rücken. Einen Schwerpunkt bilden Veröffentlichungen, die von den Anstrengungen von Mutter- und Elternschaft erzählen. Internationale Bekanntheit erlangte 2001 Rachel Cusks autobiographischer Essay A Life’s Work: On Becoming a Mother, der als einer der ersten Muttersein radikal und schonungslos schildert. Aber auch im deutschen Sprachraum sind Texte entstanden, die Mutter- und Elternschaft jenseits romantischer Verklärungen beschreiben: Essays, Romane und literarische Experimente beispielsweise von Antonia Baum (Stillleben, 2018), Mareice Kaiser (Das Unwohlsein der modernen Mutter, 2021), Julia Friese (MTTR, 2022), Maren Wurster (Eine beiläufige Entscheidung, 2022) oder dem Kollektiv Writing with CARE / RAGE (Rhizom – Offene Worte, 2021). Sie problematisieren etwa die fehlende Anerkennung für die häufig von Frauen ausgeführten und noch häufiger schlecht oder gar nicht bezahlten Sorgetätigkeiten oder reflektieren die enorme, vor allem an Mütter gestellte gesellschaftliche Erwartungshaltung. Viele der Texte beschreiben die Diskrepanz, die zwischen selbstbestimmten weiblichen Lebensentwürfen einerseits und traditionellen Rollenbildern und gesellschaftlichen Bedingungen andererseits besteht und umso deutlicher zutage tritt, sobald ein Kind da ist. „Pola Groß: KINDER KRIEGEN. KINDER HABEN. Zu zwei Neuerscheinungen“ weiterlesen
Hanna Hamel: SPIELE UND IHRE RÄUME
Beim Spielen kommt es offenbar aufs Maß an und auf die Umstände. Nicht oder nur schlecht spielen zu können gilt als Schwäche; umgekehrt erscheint es als riskant oder gefährlich, zu viel zu spielen, sich in Spielereien zu verlieren oder sogar ein falsches Spiel zu treiben. In der positiven Vorstellung des maßvollen, regelbewussten Spielens wirken bis heute Grundzüge anthropologischer Selbstbeschreibungen des 18. Jahrhunderts nach. In dieser Zeit rückte der Spielbegriff in den Fokus neuer ästhetischer Theorien, bevor er sich im 19. Jahrhundert als Gegenkonzept zu Ernst und Arbeit weiterentwickelte. Das Spiel wurde zum Aushandlungsort bürgerlichen Selbstverständnisses und gesellschaftlicher Regeln, zum Gegenstand von Theorie und Literatur.[1] „Hanna Hamel: SPIELE UND IHRE RÄUME“ weiterlesen
Alexandra Heimes: DER EINSATZ NEUER TECHNOLOGIEN IM HUMANITARISMUS UND DIE ›FRAGE NACH DER MORAL‹
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben rasante technologische Entwicklungen die Seefahrt insgesamt und damit auch das nautische Rettungswesen von Grund auf verändert. Mit motorisierten Booten, Funk- und Radartechnik – und später Rettungsflugzeugen – wird es möglich, neue notlindernde und lebensrettende Praktiken zu etablieren, die Effizienz der Maßnahmen zu steigern und zudem den geografischen Radius der Einsätze erheblich auszuweiten. Weniger offenkundig ist, in welcher Weise diese Entwicklungen auf das Gefüge der Normen und Werte zurückwirken, das der humanitären Seenotrettung zugrunde liegt, und inwiefern sie daran beteiligt sind, den Schiffbruch als einen bestimmten »Situationstyp« zu definieren.[1] Diese Aspekte bilden den Ausgangspunkt meiner Untersuchung, die der Frage nachgeht, wie sich die Herausbildung von Normen und normsetzenden Paradigmen alternativ zu den großen Erzählungen des Humanitarismus beschreiben lässt. „Alexandra Heimes: DER EINSATZ NEUER TECHNOLOGIEN IM HUMANITARISMUS UND DIE ›FRAGE NACH DER MORAL‹“ weiterlesen
Henning Trüper: SEENOT IM ARCHIPEL DER HUMANITARISMEN
Als 2008 die Finanzkrise eskalierte, vollzog sich eine irritierende Veränderung in der Semantik von ›Rettung‹. Während nämlich einerseits unbedingte Imperative der Rettung finanzieller und fiskalischer Institutionen aufkamen, whatever it takes, wurde andererseits der Rettungsimperativ für Menschen in Seenot immer problematischer. Insbesondere im Kontext von Flucht und Migration im Mittelmeerraum begannen Regierungen, humanitäre Rettungsbemühungen zu kriminalisieren, während sie doch zugleich unterlassene Hilfeleistungen ebenfalls strafrechtlich verfolgten. Über lange Zeit hatten Schiffbrüchige im öffentlichen Diskurs die Stelle als privilegierte Zielobjekte unbedingter Rettungsimperative besetzt, die sogar das Risiko eines Selbstopfers in Kauf zu nehmen verlangten. Nun schien es, als sei diese Stelle umbesetzt worden. Dass eine solche Umbesetzung aber überhaupt möglich war, warf nicht zuletzt die Frage danach auf, wie es eigentlich um die Geschichtlichkeit derartiger Imperative insgesamt bestellt ist. Diesem Problemzusammenhang geht das Forschungsprojekt »Archipelagische Imperative. Schiffbruch und Lebensrettung in europäischen Gesellschaften seit 1800« nach, indem es unter anderem untersucht, wie die Schiffbrüchigen überhaupt dazu gekommen waren, die fragliche Stelle zu besetzen. „Henning Trüper: SEENOT IM ARCHIPEL DER HUMANITARISMEN“ weiterlesen
Nebiha Guiga: SOZIALE LEBENSWELTEN UND DER ALLGEMEINE HUMANITARISMUS

Frankreichs Seenotrettungsgesellschaft, die Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), geht auf einen Zusammenschluss zweier Einrichtungen zurück, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ursprünglich unterschiedlichen Zielsetzungen entstanden sind: Die Société Centrale de Sauvetage des Naufragés (SCSN) wurde 1865 unter der Schirmherrschaft von Kaiserin Eugénie speziell zur Rettung Schiffbrüchiger gegründet. Der 1873 im bretonischen Rennes gegründeten Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons (SHSB) hingegen ging es allgemein um die Rettung von Menschen, die unverschuldet in Not geraten waren (Abb. 1, Spendenbüchse). Die Seenotrettung war für diese Gesellschaft also nur Teil eines weit größeren Projekts. So sahen die umfangreichen Regularien der SHSB den Aufbau einer Verwaltung vor, zu der auch Priester und Ärzte gehörten, die sich um das Wohlergehen aller Beteiligten kümmern sollten. Eine eigene Sektion zu Disziplinarmaßnahmen legte sogar Strafen für Gewalt gegen Tiere oder Mangel an Höflichkeit fest. Doch schon nach wenigen Jahren konzentrierte sich die SHSB entgegen ihrer ursprünglichen Zielsetzung fast ausschließlich auf die Rettung schiffbrüchiger Seeleute. In dieser Entwicklung zeigt sich eine Spannung, ein erklärungsbedürftiges Missverhältnis zwischen dem ursprünglichen, allgemeinen humanitären Anspruch und der praktischen Umsetzung konkreter Maßnahmen. „Nebiha Guiga: SOZIALE LEBENSWELTEN UND DER ALLGEMEINE HUMANITARISMUS“ weiterlesen
Lukas Schemper: HUMANITARISMUS UND SOUVERÄNITÄT
Die Rettung von Menschenleben ist eine von vielen Aktivitäten, deren Regelung souveränen Staaten obliegt. Historisch betrachtet gibt es verschiedene Definitionen von Souveränität. Seit dem 19. Jahrhundert bedeutet sie jedoch überwiegend die Kontrolle von Grenzen und die Verabschiedung von Gesetzen innerhalb derselben. So lassen sich die vielfältigen Verbindungen des Begriffs der Souveränität mit der Geschichte des Schiffbruchs und der Lebensrettung im 19. Jahrhundert auf zweierlei Weise untersuchen: Erstens ausgehend von der Souveränität als einer Form der rechtlichen, (bio)politischen, diplomatischen, territorialen bzw. maritimen Kontrolle, die zunehmend mit humanitären, kommerziellen und sicherheitspolitischen Fragen verknüpft wurde; zweitens anhand der Figur des Souveräns, der als Schirmherr und Förderer humanitärer Initiativen, einschließlich der Seenotrettungsgesellschaften, fungierte und für die Entstehung und das Selbstverständnis dieser Gesellschaften von zentraler Bedeutung war. „Lukas Schemper: HUMANITARISMUS UND SOUVERÄNITÄT“ weiterlesen
Tatjana Petzer: PARADOXIEN DER UNSTERBLICHKEIT
Im heutigen Russland knüpfen gesellschaftliche Akteure wieder offen an die sowjetische Politik des unsterblichen Kollektivs an. So erinnern neuerdings regionale Gedenkmärsche unter dem Banner des Unsterblichen Regiments (russ. Bessmertnyj polk) an Heldentum und Opfertod; Schlagworte, die im Kampf der Sowjetunion gegen Hitlerdeutschland kultiviert wurden, um das Überleben des Volkes gegen die nationalsozialistische Aggression zu sichern. Anstelle der roten Fahnen und Stalin-Porträts, die 1945 am Tag des Sieges die Militärparade flankierten, tragen die heutigen Teilnehmer:innen, darunter auch Staatschef Putin und hochrangige Politiker:innen, Fotos von Familienmitgliedern mit sich, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Das Vermächtnis der Kriegsgeneration wirkt aber nicht nur in Russland, sondern auch in anderen postsowjetischen Staaten identitätsstiftend fort, darunter in der Ukraine, wo ungeachtet einer aufgrund der Nazi-Kollaboration hiesiger Nationalisten gespaltenen Erinnerungskultur die transgenerationale Weitergabe der weltanschaulich konstruierten Unsterblichkeit auf fruchtbaren Boden fällt. „Tatjana Petzer: PARADOXIEN DER UNSTERBLICHKEIT“ weiterlesen
Leander Scholz: SYMBIOTISCHE EXISTENZEN – ZUR GESCHICHTE DES ÖKOLOGISCHEN IMAGINÄREN
I.
Am zweiten Wochenende des Oktobers 1913 versammelten sich weit über zweitausend junge Frauen und Männer auf dem Hohen Meißner in Hessen. Eingeladen zu diesem Treffen hatte eine lose Vereinigung von Jugendbünden, die den patriotischen Auswüchsen des Kaiserreichs etwas entgegensetzen wollten. Denn im gleichen Monat fanden die offiziellen Festakte zum hundertjährigen Jubiläum der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig statt, in der die napoleonischen Truppen ihre entscheidende Niederlage erlitten hatten. Anlässlich des Rückblicks auf dieses historische Ereignis sollte ein monumentales Denkmal eingeweiht werden. „Leander Scholz: SYMBIOTISCHE EXISTENZEN – ZUR GESCHICHTE DES ÖKOLOGISCHEN IMAGINÄREN“ weiterlesen