Oppenheimer (Regie: Christopher Nolan, USA 2023) hat diverse Rekorde gebrochen. Er zählt zu den erfolgreichsten Filmen mit R-Rating; schon jetzt konnte er sich unter den ganz oder in wesentlichen Teilen vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielenden Filmen den vordersten Platz sichern. Das 180 Minuten lange Biopic über den sogenannten ›Vater der Atombombe‹ stellt selbst langjährige Spitzenreiter wie Dunkirk (Regie: Christopher Nolan, USA 2017) oder Saving Private Ryan (Regie: Steven Spielberg, USA 1998) in den Schatten. Mit einem erlesenen Star-Ensemble und einem Budget von 100 Millionen US-Dollar hat Nolan ein dunkles Historienspektakel geschaffen, das angesichts revolutionärer KI-Entwicklungssprünge, menschengemachter Klimaveränderungen und wiederaufkeimender geopolitischer Bedrohungen erschreckend aktuell ist. Wieder einmal sieht sich die Menschheit mit ihren selbstzerstörerischen Kräften konfrontiert.

Die Geschichte ist bekannt: Von 1943 bis 1945 arbeitete unter der wissenschaftlichen Leitung von J. Robert Oppenheimer ein Heer von Ingenieuren und hochkarätigen Forschern in der abgelegenen Retortenstadt Los Alamos an der Entwicklung einer Nuklearwaffe, um den Bemühungen Nazideutschlands um eine militärische Anwendung der kürzlich entdeckten Kernspaltung zuvorzukommen. Die Bombe ist für das Marketing des Films von zentraler Bedeutung. Wie die Filmplakate (Abb. 1) bedienen auch die Trailer in erster Linie die morbide Neugier, eine Kernexplosion nicht nur sehen, sondern förmlich miterleben zu können: ein bombastisches Fanal, wie es anscheinend nur Christopher Nolan, der Großmeister des Überwältigungskinos, in Szene zu setzen vermag.
In der Tat gelingt es dem Film, anhaltend Spannung aufzubauen. Von Anfang an prophezeien klickende Geigerzähler sowie das Grollen und Flimmern imaginierter nuklearer Prozesse den Weltenbrand, der zwei Stunden später nach einem zeitdeckend heruntergezählten Countdown den Beginn einer neuen Zeitrechnung markiert. Todessüchtig scheint der Film auf die zentrale Szene (über‑)menschlicher Zerstörungslust zuzulaufen, auf nichts weniger als eine »terrible revelation of divine power« (Oppenheimer in Oppenheimer über die Atombombe). Glaubt man der physikalisch affizierten Bombenmetaphorik des Feuilletons, liefert Nolan, was die Werbung verspricht. So fabuliert die NZZ von »Nolans Teilchenbeschleuniger«, der »massiv Druckwellen über die Leinwand« jage, von einer »Kernwaffe des Kinos«, einem »cineastische[n] Wettrüsten«, nach dem »das Publikum, geplättet und verstrahlt, aus den Sitzen geschabt werden« müsse.[1] Da stellt sich die Frage: Muss man einen solchen Film gesehen haben?
Narrative Komplexität
Zunächst einmal: Bildsprachliche Plattitüden liegen in Anbetracht der audiovisuellen Strahlkraft des mit superhochauflösenden 65-mm-IMAX- und Panavision-Kameras gedrehten Films nahe. Sie verengen jedoch den Blick zu stark auf dessen technische Schauwerte. Oppenheimer ist nämlich auch in narrativer Hinsicht überaus geschickt gestrickt. Der Plot, der den Zuschauer*innen zumindest in groben Zügen bekannt sein dürfte, wird durch die Einführung verschiedener Erzählebenen mit gegenläufig aufgebauten Spannungsbögen und dramaturgischen Verästelungen in permanente Dynamik versetzt. So sind trotz grob chronologischer Organisation der episodenhaften Einblicke in Oppenheimers Leben die einzelnen Fragmente achronologisch angeordnet und assoziativ verknüpft. Das Wechselspiel von grobkörnigen Farb- und Schwarz-Weiß-Passagen fungiert nicht nur als zeitliche Richtschnur, sondern dient zunehmend auch der Konturierung von Oppenheimers Innen- und einer stärker objektivierten Außensicht.

Oppenheimer will viel: Es geht um Aufstieg und Fall einer scheinbar gleichermaßen genialen wie kapriziösen Forscherpersönlichkeit, um politische und romantische Irrungen und Wirrungen, um die großen Fragen von Wissensdrang und Schuld, Reue und Verantwortung, Kontrolle und Kontrollverlust – und das vor dem am Horizont dräuenden Gegenlicht eines menschengemachten Infernos. Die Bombe ist mehr als eine hochtechnisierte Version von Frankensteins Monster oder eines außer Kontrolle geratenen Golems. Sie ist vor allem ein ambigues Symbol dafür, was passieren kann, wenn Wissenschaft, Politik und Militär zu einer geradezu allmächtigen Funktionseinheit verschmelzen (Abb. 2). Dann wird der Krieg zum Vater aller Dinge, zum Gebieter, der moralische Argumente in ein Schattendasein zwingt. Wer hier Bedenken äußert, muss sich in den Räumen der Macht als humanitätsduseliges »cry baby« (Truman in Oppenheimer über Oppenheimer) verspotten lassen.
Oppenheimer bietet auch viel – vielleicht sogar zu viel: In seinem Anspruch auf historische Akkuratesse wirkt der Film mitunter wie die bildgewaltige Adaptation eines Wikipedia-Artikels. So wird das Publikum mit einer Kaskade von Wissenschaftlernamen konfrontiert, die fast schon eine prosopographische Registratur erfordert: Teller, Rabi, Fermi, Lawrence, Bethe, Fuchs, Feynman, Gödel, Serber, Alvarez, Bainbridge, Neddermeyer, Morrison, Kistiakowsky, Condon, Snyder, Heisenberg, Diebner, Bothe, von Weizsäcker, Bohr – und natürlich darf auch Einstein als in die Popkultur eingegangene Ikone wissenschaftlicher Genialität und Besonnenheit nicht fehlen. Selbst ausführliche Dokumentarfilme zum Manhattan-Projekt sind in Sachen Namedropping sehr viel zurückhaltender. Einzig die Vulgärnamen der beiden Schattenmacher, ›little boy‹ und ›fat man‹, werden in Nolans Film komplett ausgespart – was umso bemerkenswerter erscheint, als sie in der letzten größeren Verspielfilmung des Stoffes, Roland Joffés Fat Man and Little Boy (USA 1989), noch titelgebend waren.

Oppenheimer setzt andere Prioritäten. Die Bombe ist zwar eine dauerpräsente Requisite, zelebriert wird aber (angefangen mit Cillian Murphy) ein dialoglastiges ›Kino der Gesichter‹ (Abb. 3). Dass diesen bisweilen allzu prominenten Gesichtern (Matt Damon, Robert Downey Jr., Gary Oldman, Matthias Schweighöfer usw.) bis in randständige Nebenrollen hinein die Namen historischer Personen zugeordnet werden, zeugt von einem dokumentarischen Gestus, der leicht übersehen lässt, dass konkrete Konstellationen (z.B. die Begegnung Oppenheimers mit Bohr in Cambridge) dem Reich der Fiktion entspringen.
Die sonst so gern bemühte Frage nach der ›Faktizität‹ der dargestellten Geschichte weiß Nolan indes geschickt zu umgehen. Das liegt vor allem an der konsequenten Perspektivierung: Von Beginn an zieht der dynamische Schnitt des Films die Zuschauer*innen in einen Stream of Consciousness von Empfindungen, Begegnungen, Erinnerungsfragmenten und abstrakt-bedrohlichen »visions of a hidden universe« (Oppenheimer in Oppenheimer über seine Halluzinationen). Gezeigt wird weniger, »wie es eigentlich gewesen«, als vielmehr, wie Oppenheimer das Geschehen erlebt haben mag. Expressive Nahaufnahmen saugen das Publikum förmlich in die Gedanken- und Gefühlswelt des Protagonisten und bauen ihn als tragische, innerlich zerrissene Gestalt auf. So wird Oppenheimer ganz im Sinne der biographischen Buchvorlage[2] als American Prometheus in Szene gesetzt, der mit Trinity, Code-Name des ersten erfolgreichen Kernwaffentests, eben nicht nur die Initialzündung für das Atomzeitalter lieferte, sondern nach dem – im Film etwas platt durch einen vergifteten Apfel symbolisierten – Sündenfall der Wissenschaft die Folgen seines politischen (und moralischen?) Absturzes in der McCarthy-Ära in unerwarteter Ausführlichkeit auszusitzen hat.
Perspektivierungen
Die erfolgreichen Verfilmungen des Lebens von John Nash (A Beautiful Mind, Regie: Ron Howard, USA 2001) und von Stephen Hawking (The Theory of Everything, Regie: James Marsh, USA 2014) haben bereits gezeigt, das namhafte Wissenschaftler in der Traumfabrik durchaus eine lukrative Rolle spielen können. Oppenheimer steht inhaltlich in dieser Tradition des klassischen Biopics, orientiert sich stilistisch jedoch an eher extravaganten Genre-Vertretern wie Amadeus (Regie: Miloš Forman, USA 1984) oder JFK (Regie: Oliver Stone, USA 1991) und nimmt in nicht unerheblichen Passagen Anleihen beim Gerichtsfilm. Dabei bleibt er der genretypischen Idolisierung der Wissenschaftlerfigur verhaftet: Präsentiert wird ein vielseitig gebildetes, polyglottes Universalgenie mit faustisch-pathologischem Wissensdrang, beständig an der Kippe zwischen »Brillanz« und Wahnsinn, das die Revolution der Physik kenntnisreich mit den Revolutionen der Kunst (Picasso!), der Musik (Strawinsky!), der Politik und Psychologie (Marx! Freud! Jung!) in Beziehung zu setzen vermag und zudem mit den Qualitäten eines idealistischen politischen Märtyrers ausgestattet ist. Inwiefern eine solche Charakterisierung historisch haltbar ist, sei dahingestellt.[3]
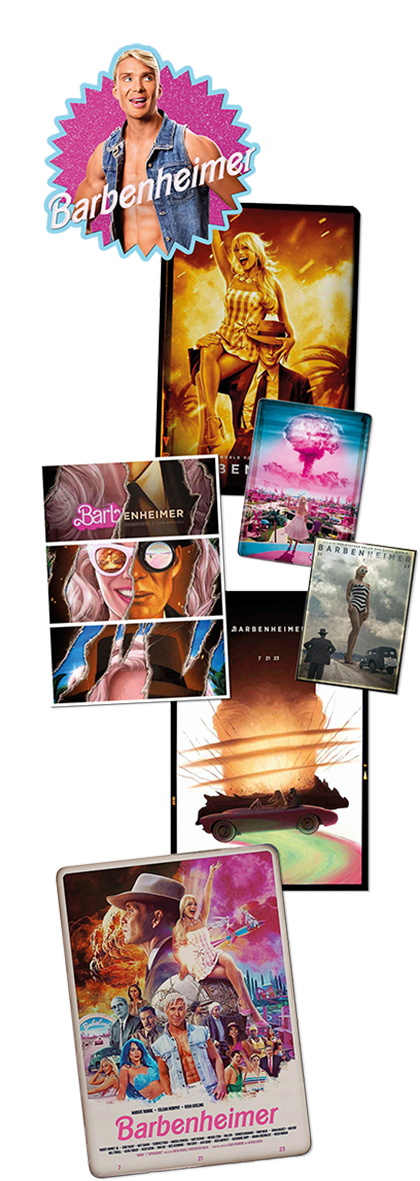
»Brilliance is taken for granted in your circle«, stutzt Oppenheimers schnauzbärtiger Sidekick Lt. General Groves den von ihm selbst auserkorenen wissenschaftlichen Leiter des milliardenschweren Forschungsvorhabens zurecht. Immer wieder nimmt Nolan über solche Nebenfiguren kluge diskursive Nuancierungen vor, entmystifiziert beiläufig die Oppenheimer’sche Sicht auf die Dinge. Das hat der Film auch nötig, bedenkt man seine unleugbaren blinden Flecken: Was ist mit den im Rahmen des Manhattan-Projekts vorgenommenen, ethisch höchst fragwürdigen Radiationsexperimenten? Oder dem nachhaltigen Schaden, den die frühen Atombombentests an den native communities z.B. in der Jornada del Muerto, dem Gelände des Trinity-Tests, angerichtet haben? Inszeniert Nolan mit Oppenheimer und seiner durchweg maskulinen Welt, in der Frauen ein eher unterbelichtetes Dasein im Schatten ihrer genialen Gatten fristen, nicht einen fast schon biederen ›Große-Männer-Film‹? – Natürlich, nur so konnte das taggenau terminierte Barbie-Counter-Programming jenen cineastischen Synergieeffekt zeitigen, der in den zahlreichen Barbenheimer-Memes (Abb. 4) einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Doch selbst in dieser Hinsicht sorgen Nebenfiguren für ein differenzierteres Gesamtbild: Über die scharfsichtige Figur der Kitty Oppenheimer, die ihre aufgezwungene Rolle als Ehefrau und Mutter fast schon selbstbewusst im Alkohol ertränkt, sowie die emanzipiert auftretende Chemikerin Lilli Hornig wird das historische Geschlechterverhältnis zumindest als problematisch markiert.
Fragen der Anschaulichkeit
Ein Film kann (und muss) nicht alles zeigen. Vieles ist belanglos, manches wiederum so erschütternd, dass es – jenseits cinematischer Spiegelung – geradezu paralysierend wirkt.[4] Gute Filme sind nicht ohne Grund oft Imaginationsvehikel. Sie erschließen und re-präsentieren Bilder, die in den Köpfen ihres Publikums längst eingelagert sind. In einem solchen Sinn kann Nolan das ikonische Potenzial des ersten Atompilzes voll ausschöpfen, wenn er diesen in ungewohnter Farbenpracht und Strahlkraft verbildlicht – und sich damit gewissermaßen in die Tradition Edward Steichens stellt, dessen von Kracauer bis Barthes vielfältig rezipierte S/W-Fotoinstallation The Family of Man (1951) bekanntlich auf das in Farbe gehaltene Lichtbild einer nuklearen Explosion zuläuft. Gewiss ist die filmische Simulation einer ›echten Bombe‹ reines Handwerk. Die inszenatorische Kunst besteht darin, erst mit einiger Verzögerung die existenzphilosophische Schockwelle einsetzen zu lassen, mit der etwa bei Günther Anders und Karl Jaspers das atomare (End‑)Zeitalter seinen Anfang nimmt.[5]
Interessant ist, was im Dunkeln bleibt – nämlich in erster Linie das humanitäre Elend in Hiroshima und Nagasaki. Lediglich in düster flackernden Visionen deuten sich die unmenschlichen Auswirkungen der atomaren Detonationen an. Freilich sind in Oppenheimers Halluzination nicht etwa die Einwohner*innen der japanischen Städte von den Konsequenzen ›seiner‹ Erfindung betroffen, sondern, wohl in Vorausahnung einer künftigen sowjetischen Bombe, seine ihm nach dem Abwurf begeistert zujubelnden Mitarbeiter*innen. Mit einer gewissen »Apokalypse-Blindheit« (Günther Anders) geschlagen, in der die Atombombe zu einem zwar fürchterlichen, doch nicht mehr fassbaren Instrument moderner Kriegsführung vergeistigt wird, ist Oppenheimer in der Tat Zerstörer von (abstrakten) Welten – und nicht von menschlichen Individuen. Dass der Film in Japan, aber auch in japanischstämmigen Communities der USA sehr kritisch und als »morally half-formed« aufgenommen wird, verwundert wenig.[6]
Für einen Film über moderne Physik und ihre politischen Verstrickungen, der selbst für das physikalisch Undarstellbare ästhetische Bilder findet, ist die Ausblendung ihrer Opfer jedenfalls eine bemerkenswerte Entscheidung. Verbietet wirklich der »Respekt vor den Opfern der US-Atombombenabwürfe«[7] eine wie auch immer geartete Verbildlichung? Ist das eine Frage der Pietät oder nicht doch victim erasure? Für ein Paar nackter Brüste hat die Produktionsfirma bereitwillig ein R-Rating in Kauf genommen. Es kann also nicht an der Altersfreigabe in den USA liegen, dass man Oppenheimer in einem Briefing über den militärischen Einsatz der Bomben nicht über die Schulter blickt, sondern nur beim bedeutungsschwangeren Wegschauen zuschaut. Das atomare Grauen offenbart sich, wenn überhaupt, nur als scheinbar tiefsinniger Reflex in Oppenheimers wasserblauen Augen.
Das Problem ist nicht neu: Bereits John Herseys Reportage im New Yorker (1946), die nach der anfänglich euphorischen Befürwortung des noiseless flash auch in den USA eine Art von »Atommoral« (Hans Blumenberg) wachrief, führte das Leid der Betroffenen zensurbedingt rein sprachlich vor Augen.[8] Filmische Adaptionen wie Joffés Schattenmacher oder die BBC-Serie Oppenheimer (Regie: Barry Davis, GB 1980) bildeten die japanischen Opfer ebenso wenig ab wie The Family of Man, zu der auch in Hiroshima tätige Kriegsfotografen beigetragen haben. Vor diesem Hintergrund wirkt Nolans Ansatz nicht nur unoriginell, sondern geradezu antiquiert. In Anbetracht gegenwärtig auflebender Bedrohungsszenarien wirft der Film die Frage auf, ob die Nicht-Darstellung, die hinter künstlerisch ambitioniertere Ansätze zurückzufallen scheint, mit einem zwischenzeitlich totgeglaubten Endzeitdiskurs korrespondiert, wie er im deutschen Sprachraum etwa bei Karl Jaspers, Erwin Chargaff und anderen kulturpessimistischen Wissenschafts- und Technikkritikern fassbar wird. Wozu die Bombe noch immer als »ontologisches Unikat« (Anders) sakralisieren?
Slavoj Žižek hat in einem in der Berliner Zeitung erschienenen Artikel an Oppenheimer nur eines auszusetzen: Der Film versäume es, »deutlich zu machen, dass die Beschwörung jeglicher Art von ›spiritueller Tiefe‹ den Schrecken der neuen, von der Wissenschaft hervorgebrachten Realität vernebelt«. Um der ›nackten Apokalypse‹ entgegenzutreten, brauche es das »Gegenteil von spiritueller Tiefe: einen völlig respektlosen komischen Geist«[9] – ganz klassisch: Lachen als Mittel der Entspannung. Das ist natürlich nicht der einzig mögliche Weg: Während Alain Resnais in Hiroshima, mon amour (F 1959) dokumentarische Elemente mit fiktionalisierten Szenen zu einem poetischen Bilderstrom verwebt, ist in dem auf einer autobiografischen Graphic Novel basierenden Anime-Film Barfuß durch Hiroshima (Regie: Mori Masaki, J 1983) die Sequenz des Bombenabwurfs in ihrer zeichnerischen Drastik schwer auszuhalten. Womöglich hätte wenigstens die Suggestion eines Einbruchs historischer Empathie in die filmische Realität auch Oppenheimer gutgetan.
Oppenheimer ist ein sehenswerter Film. Man sollte sich allerdings im Klaren darüber sein, dass er sich darin genügt, die Banalität einer Wissenschaft auszustellen, die im Krieg einfach zu funktionieren hat: Was gemacht werden kann, wird gemacht. Das Nachdenken darüber kommt – wie die Sichtbarkeit der Fortschrittskonsequenzen – immer erst ex post. Gerade mit Blick auf die historische Person Oppenheimer wird die gleichzeitig betriebene Mythisierung damit fragwürdig. Anstatt Oppenheimer zum modernen Prometheus, zum Vordenker amerikanischen Könnensbewusstseins zu stilisieren, hätte man mit gleichem Recht dessen weniger berühmten Bruder als mythische Vorlage wählen können. Schließlich war Epimetheus, der Nachdenker, dafür verantwortlich, dass die Büchse der Pandora in die Welt der Menschen kam.
Die Chemikerin und Literaturwissenschaftlerin Magdalena Gronau ist Freigeist-Fellow der VolkswagenStiftung. Gemeinsam mit dem Althistoriker Martin Gronau bearbeitet sie am ZfL das Projekt »Die Philologie der Physiker. Angewandtes Textwissen in der Wissenschaftskultur der Quantenphysik«.
Gefördert von der VolkswagenStiftung.
[1] Andreas Schreiner: »Dr. Oppenheimer oder: Wie er lernte, die Bombe zu lieben«, in: Neue Zürcher Zeitung, 19.7.2023.
[2] Kai Bird/Martin J. Sherwin: American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, New York 2006.
[3] Der Wissenschaftshistoriker David Cassidy hat kürzlich in einem Interview darauf aufmerksam gemacht, dass im Fall Oppenheimers von Genialität nicht unbedingt die Rede sein kann – und noch viel weniger von politischer Naivität und Märtyrertum. Adrian Cho: »Oppenheimer hätte einen Nobelpreis bekommen«, in: Süddeutsche Zeitung, 25.7.2023.
[4] Vgl. Siegfried Kracauer: Theory of Film. The Redemption of Physical Reality, with an Introduction by Miriam Bratu Hansen, Princeton, NJ 1997 [1960], S. 305.
[5] Vgl. Ilona Stölken-Fitschen: »Der verspätete Schock. Hiroshima und der Beginn des atomaren Zeitalters«, in: Michael Salewski/Ilona Stölken-Fitschen (Hg.): Moderne Zeiten. Technik und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1994, S. 139–155.
[6] Emily Zemler: »Critics say omitting the Japanese toll makes ›Oppenheimer‹ ›morally half-formed‹«, in: Los Angeles Times, 4.8.2023.
[7] Michael Schleicher: »›Oppenheimer‹ von Christopher Nolan: Der Popstar der Physik«, in: Merkur, 19.7.2023.
[8] John Hersey: »Hiroshima«, in: The New Yorker, 23.8.1946.
[9] Slavoj Žižek: »Slavoj Zizek über ›Indiana Jones‹, ›Barbie‹ und ›Oppenheimer‹: Wer verträgt die Wahrheit nicht?«, in: Berliner Zeitung, 20.7.2023.
VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: Magdalena Gronau/Martin Gronau: Physiker in der (Alb-)Traumfabrik. Christopher Nolans Oppenheimer, in: ZfL Blog, 31.8.2023, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2023/08/31/magdalena-gronau-martin-gronau-physiker-in-der-alb-traumfabrik-christopher-nolans-oppenheimer].
DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20230831-01

