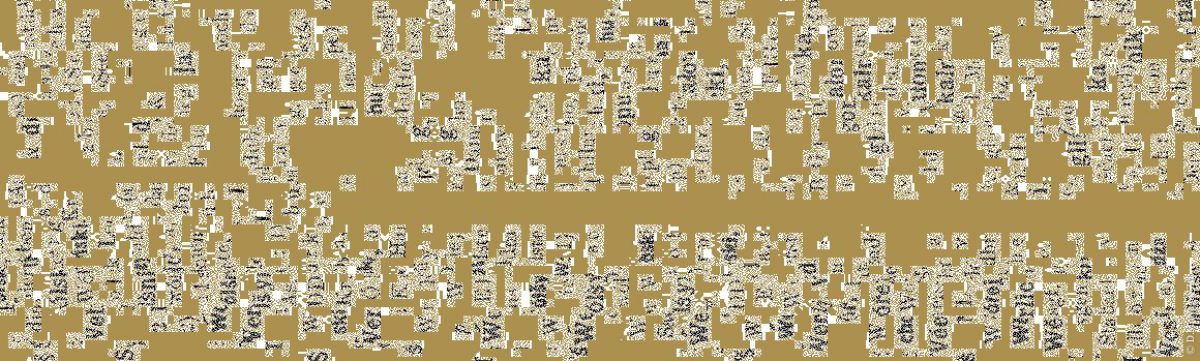›Biodiversität‹ ist ein Schlüsselbegriff unserer Zeit, auf dem Forschungsprogramme, ethische Debatten zum Mensch-Natur-Verhältnis und politische Aktivitäten basieren. In der öffentlichen und politischen Kommunikation funktioniert der Begriff offenbar gut. Er transportiert Achtung und Verantwortung für die Natur, Toleranz gegenüber dem Fremden, Freude an der Heterogenität und Mannigfaltigkeit. Biodiversität steht parallel zur kulturellen Vielfalt und passt in unsere durch Pluralismen geprägte Gegenwart. Denn der Begriff drückt nicht nur Enthierarchisierung und Pluralisierung der Perspektiven aus, Verzicht auf eine übergreifende, durchgängig gültige Ordnung und den Eigensinn und Eigenwert jedes einzelnen, auch nichtmenschlichen Wesens. Er steht auch für das Zusammenführen von wissenschaftlichen mit ethischen, ästhetischen und ökonomischen Aspekten eines Gegenstands und für die Hoffnung auf den letztlich harmonischen Zusammenklang des vielstimmigen Mit- und Gegeneinanders. „Georg Toepfer: BIODIVERSITÄT“ weiterlesen