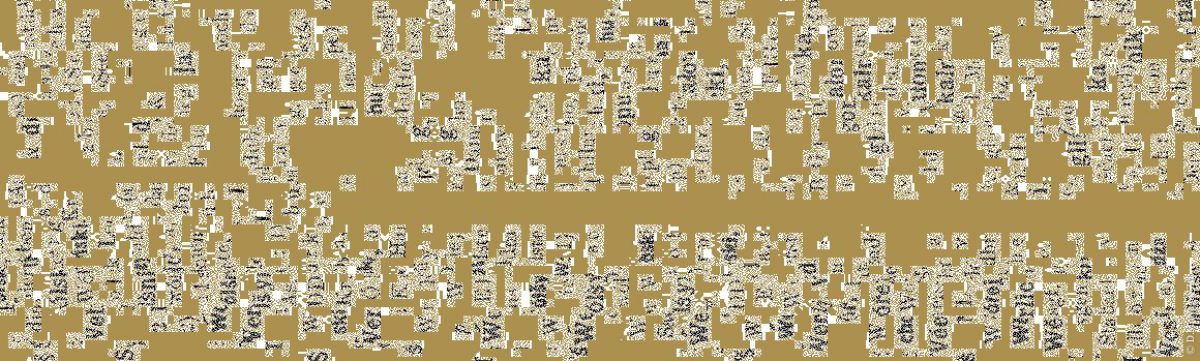Zum Jahreswechsel 2023/2024 gelang einer russischen Fernsehserie, was während Russlands Krieg gegen die Ukraine eigentlich unvorstellbar scheint: Innerhalb weniger Tage entwickelte sich Ehrenwort eines Kerls. Blut auf dem Asphalt (Slowo pazana. Krow na asfalte, 2023) beiderseits der Schützengräben zur populärsten Serie des Jahres. Die Zuschauer- und Klickzahlen erreichten Rekordhöhen und der Titelsong Pyjala (dt. ›Glas‹) der tatarischen Band Aigel schaffte es an die Spitze diverser Hitparaden in beiden Ländern.[1] In der Russischen Föderation war die Serie zwar mit der Altersgrenze »18+« versehen und nur bei den privaten Streamingdiensten Wink und START zu sehen.[2] Doch schon während der Ausstrahlung der acht Folgen der ersten Staffel vom 9. November bis 21. Dezember 2023 verbreitete die Serie sich blitzschnell über Telegram und andere digitale Kanäle. Sätze wie »Kerle entschuldigen sich nicht« oder »Denk dran, du bist jetzt ein Kerl, du bist jetzt auf der Straße, und ringsherum sind Feinde« wurden zu geflügelten Worten. Pädagogen und Politikerinnen schlugen Alarm, als in der Presse Berichte auftauchten, die von durch die Serie inspirierten Schlägereien berichteten, und zwar sowohl in Russland als auch in der Ukraine.[3] „Matthias Schwartz: IN DER WELT DER WILDEN KERLE. Eine populäre Serie im Zeichen des russisch-ukrainischen Krieges“ weiterlesen
Kategorie: LEKTÜREN
Jakob Moser: »DAS DÄMONISCHE BERLIN«: WALTER BENJAMIN ÜBER E. T. A. HOFFMANN
Wie die Literatur- und Theoriegeschichte zeigt, wurde das Dämonische im Gefolge von Goethe auf wirkmächtige Weise von den Dämonen entkoppelt.[1] Walter Benjamin brachte vor diesem Hintergrund E. T. A. Hoffmann ins Spiel, einen Schriftsteller, dessen »fieberhafte Träume« Goethe verschmähte.[2] Unter dem Titel Das dämonische Berlin sprach Benjamin im Februar 1930 in der Kinderstunde des Berliner Rundfunks über Hoffmann als Dichter der Großstadt.[3] Obwohl das Wort »dämonisch« nur im Titel fällt, eröffnet der Vortrag eine neue Sicht auf das post-goethesche Dämonische, denn die Medialität des Dämonischen wird darin auf mehreren Ebenen reflektiert, die das Radio selbst involvieren. „Jakob Moser: »DAS DÄMONISCHE BERLIN«: WALTER BENJAMIN ÜBER E. T. A. HOFFMANN“ weiterlesen
Falko Schmieder: SOZIODIZEE DES KAPITALISMUS
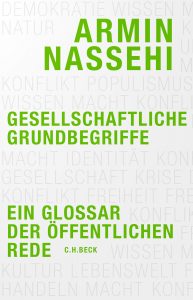 In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Glossare zu Leitvokabeln der Gegenwart entstanden, auffällig oft konzipiert von Soziolog*innen. Mit diesem flexiblen Genre lässt sich auf die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, die auch in der Sprache ihren Niederschlag finden. Die Transformationen der Semantik indizieren tiefgreifende Wandlungen kollektiver Wahrnehmungsweisen, Erwartungshaltungen sowie Zeitvorstellungen; ihre Analyse dient so einer historischen Selbstaufklärung der Gegenwart, die sich mit wachsender Geschwindigkeit selbst überholt und ins Präzedenzlose vorstößt. Armin Nassehis Buch zu gesellschaftlichen Grundbegriffen setzt diese Reihe soziologischer Standortbestimmungen im Medium der Sprachreflexion fort (Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München: Beck 2023). „Falko Schmieder: SOZIODIZEE DES KAPITALISMUS“ weiterlesen
In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Glossare zu Leitvokabeln der Gegenwart entstanden, auffällig oft konzipiert von Soziolog*innen. Mit diesem flexiblen Genre lässt sich auf die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, die auch in der Sprache ihren Niederschlag finden. Die Transformationen der Semantik indizieren tiefgreifende Wandlungen kollektiver Wahrnehmungsweisen, Erwartungshaltungen sowie Zeitvorstellungen; ihre Analyse dient so einer historischen Selbstaufklärung der Gegenwart, die sich mit wachsender Geschwindigkeit selbst überholt und ins Präzedenzlose vorstößt. Armin Nassehis Buch zu gesellschaftlichen Grundbegriffen setzt diese Reihe soziologischer Standortbestimmungen im Medium der Sprachreflexion fort (Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München: Beck 2023). „Falko Schmieder: SOZIODIZEE DES KAPITALISMUS“ weiterlesen
Magdalena Gronau/Martin Gronau: PHYSIKER IN DER (ALB-)TRAUMFABRIK. Christopher Nolans Oppenheimer
Oppenheimer (Regie: Christopher Nolan, USA 2023) hat diverse Rekorde gebrochen. Er zählt zu den erfolgreichsten Filmen mit R-Rating; schon jetzt konnte er sich unter den ganz oder in wesentlichen Teilen vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielenden Filmen den vordersten Platz sichern. Das 180 Minuten lange Biopic über den sogenannten ›Vater der Atombombe‹ stellt selbst langjährige Spitzenreiter wie Dunkirk (Regie: Christopher Nolan, USA 2017) oder Saving Private Ryan (Regie: Steven Spielberg, USA 1998) in den Schatten. Mit einem erlesenen Star-Ensemble und einem Budget von 100 Millionen US-Dollar hat Nolan ein dunkles Historienspektakel geschaffen, das angesichts revolutionärer KI-Entwicklungssprünge, menschengemachter Klimaveränderungen und wiederaufkeimender geopolitischer Bedrohungen erschreckend aktuell ist. Wieder einmal sieht sich die Menschheit mit ihren selbstzerstörerischen Kräften konfrontiert. „Magdalena Gronau/Martin Gronau: PHYSIKER IN DER (ALB-)TRAUMFABRIK. Christopher Nolans Oppenheimer“ weiterlesen
Pola Groß: KINDER KRIEGEN. KINDER HABEN. Zu zwei Neuerscheinungen
Kinderbetreuung, Hausarbeit und Pflege älterer Menschen gehören nicht zu den Tätigkeiten, die in der Literatur bislang viel Raum eingenommen haben.[1] Seit einiger Zeit ändert sich das und es erscheinen zunehmend Texte, die Sorgearbeit ins Zentrum rücken. Einen Schwerpunkt bilden Veröffentlichungen, die von den Anstrengungen von Mutter- und Elternschaft erzählen. Internationale Bekanntheit erlangte 2001 Rachel Cusks autobiographischer Essay A Life’s Work: On Becoming a Mother, der als einer der ersten Muttersein radikal und schonungslos schildert. Aber auch im deutschen Sprachraum sind Texte entstanden, die Mutter- und Elternschaft jenseits romantischer Verklärungen beschreiben: Essays, Romane und literarische Experimente beispielsweise von Antonia Baum (Stillleben, 2018), Mareice Kaiser (Das Unwohlsein der modernen Mutter, 2021), Julia Friese (MTTR, 2022), Maren Wurster (Eine beiläufige Entscheidung, 2022) oder dem Kollektiv Writing with CARE / RAGE (Rhizom – Offene Worte, 2021). Sie problematisieren etwa die fehlende Anerkennung für die häufig von Frauen ausgeführten und noch häufiger schlecht oder gar nicht bezahlten Sorgetätigkeiten oder reflektieren die enorme, vor allem an Mütter gestellte gesellschaftliche Erwartungshaltung. Viele der Texte beschreiben die Diskrepanz, die zwischen selbstbestimmten weiblichen Lebensentwürfen einerseits und traditionellen Rollenbildern und gesellschaftlichen Bedingungen andererseits besteht und umso deutlicher zutage tritt, sobald ein Kind da ist. „Pola Groß: KINDER KRIEGEN. KINDER HABEN. Zu zwei Neuerscheinungen“ weiterlesen
Oliver Precht: AUCH EINE GESCHICHTE DER THEORIE
 »Das Folgende«, stellt Morten Paul gleich zu Beginn seiner Studie über Suhrkamps (mehr oder weniger) graue Bände klar, »ist keine Geschichte der Theorie, sondern eine Geschichte der Theorie-Reihe« (Morten Paul: Suhrkamp Theorie. Eine Buchreihe im philosophischen Nachkrieg, Leipzig: Spector Books 2023, 18). Vielleicht hatte er beim Verfassen dieses Warnhinweises noch den Vorwurf im Ohr, den Gerhard Poppenberg in seinem Essay Herbst der Theorie an Philipp Felschs viel gelesenes Buch Der lange Sommer der Theorie gerichtet hat: Felsch verenge die komplexe, an eine Vielzahl von Orten, Institutionen, Produktions- und Rezeptionsmilieus gebundene Theoriegeschichte auf die spezifischen von ihm untersuchten Kontexte, nämlich auf »die Verlage Suhrkamp und Merve, die Berliner FU und die Subkultur der Siebziger- und Achtzigerjahre«.[1] Hinter diesem etwas wohlfeilen Vorwurf steht eine Vorstellung von Theoriegeschichte, die sich keineswegs von selbst versteht. „Oliver Precht: AUCH EINE GESCHICHTE DER THEORIE“ weiterlesen
»Das Folgende«, stellt Morten Paul gleich zu Beginn seiner Studie über Suhrkamps (mehr oder weniger) graue Bände klar, »ist keine Geschichte der Theorie, sondern eine Geschichte der Theorie-Reihe« (Morten Paul: Suhrkamp Theorie. Eine Buchreihe im philosophischen Nachkrieg, Leipzig: Spector Books 2023, 18). Vielleicht hatte er beim Verfassen dieses Warnhinweises noch den Vorwurf im Ohr, den Gerhard Poppenberg in seinem Essay Herbst der Theorie an Philipp Felschs viel gelesenes Buch Der lange Sommer der Theorie gerichtet hat: Felsch verenge die komplexe, an eine Vielzahl von Orten, Institutionen, Produktions- und Rezeptionsmilieus gebundene Theoriegeschichte auf die spezifischen von ihm untersuchten Kontexte, nämlich auf »die Verlage Suhrkamp und Merve, die Berliner FU und die Subkultur der Siebziger- und Achtzigerjahre«.[1] Hinter diesem etwas wohlfeilen Vorwurf steht eine Vorstellung von Theoriegeschichte, die sich keineswegs von selbst versteht. „Oliver Precht: AUCH EINE GESCHICHTE DER THEORIE“ weiterlesen
Barbara Picht: HANS JONAS IM RADIOINTERVIEW
Am 10. Mai 2023 jährt sich der Geburtstag des Philosophen Hans Jonas zum 120. Mal, der 5. Februar war sein 30. Todestag. Dies soll Anlass sein, auf ein Interview mit ihm hinzuweisen, das 1988 erstmals im Radio ausgestrahlt wurde und seit kurzem wieder zugänglich ist. Geführt wurde das Gespräch von dem Journalisten Harald von Troschke (1924–2009), der für die Aufzeichnung einen Besuch des aus den USA angereisten Hans Jonas’ in Heidelberg nutzte. Von Troschke war vielen Radiohörerinnen und -hörern durch seine rund einstündigen Porträtsendungen bekannt, die in den 1960er bis 1980er Jahren vom Norddeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk und weiteren Sendern im In- und Ausland ausgestrahlt wurden. Da von Troschke, unterstützt zunächst von seiner Frau, später auch von seinen drei Kindern, seine Beiträge selbst produzierte, behielt er die Rechte an den Sendungen. Seit 2020 kann sein Audionachlass deshalb im digitalen Harald von Troschke-Archiv präsentiert werden, wo sich auch das Interview mit Hans Jonas nachhören lässt.[1] „Barbara Picht: HANS JONAS IM RADIOINTERVIEW“ weiterlesen
Franziska Thun-Hohenstein: ANDREJ TARKOVSKIJS »SOLARIS«. Ein Wiedersehen
I.
Ende 1972, vielleicht war es auch Anfang 1973, lief im Hauptgebäude der Moskauer Lomonossow-Universität eine Voraufführung von Andrej Tarkovskijs Spielfilm Solaris. Auf einer Forschungsstation über dem riesigen Ozean des Planeten Solaris soll der Psychologe Chris Kelvin dabei helfen, seltsame Vorgänge aufzuklären. Die Wissenschaftler werden dort von menschlichen Wesen ›besucht‹, die Projektionen ihrer eigenen quälenden Erinnerungen sind. Ohne die Aussicht, das Rätsel des Ozeans je zu lösen und ins Vaterhaus auf der Erde zurückzukehren, bleibt Kelvin schließlich auf der Station.
Ich hatte das Glück, bei der einmaligen Filmvorführung dabei zu sein.[1] Aus der DDR kommend, war ich damals Studentin der russischen Sprache und Literatur an der Lomonossow-Universität und wohnte im Wohnheim in einem Seitenflügel des markanten Stalinhochhauses auf den Sperlingsbergen, die damals Leninberge hießen. Das genaue Datum vermag ich nicht mehr zu rekonstruieren. Der Kinoabend ist mir allerdings schon durch seine ungewöhnlichen äußeren Umstände in Erinnerung geblieben. An Eintrittskarten gelangten meine Freunde und ich nur, weil die russische Freundin eines DDR-Promotionsstipendiaten an der Kasse aushalf. Der Andrang unmittelbar vor der Aufführung war enorm. Im Innern, im Vestibül des Kulturhauses, das sich im Hauptgebäude befindet, versuchte berittene Miliz der von außen immer weiter nachdrängenden Massen Herr zu werden. Ihr Anblick erschreckte mich, obwohl kaum mehr als ein oder zwei Pferde in den Raum gepasst haben konnten. „Franziska Thun-Hohenstein: ANDREJ TARKOVSKIJS »SOLARIS«. Ein Wiedersehen“ weiterlesen
Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS
Die Ausgabe Nr. 17 vom Oktober 2022 der chilenischen Kulturzeitschrift Papel Máquina ist der Arbeit der ehemaligen Direktorin des ZfL Sigrid Weigel gewidmet. Wir danken der Schriftstellerin Yoko Tawada für die Erlaubnis, ihren dort in spanischer Übersetzung erschienenen Beitrag im ZfL BLOG erstmals in der deutschen Originalfassung veröffentlichen zu dürfen.
Neulich nahm ich ein Buch von Sigrid Weigel in die Hand, das 1982 erschienen ist. Normalerweise bleiben alle Buchtitel auf einer Publikationsliste brav in einer chronologischen Reihe, und selbst wenn die Schlange sehr lang ist, was bei Weigel zweifellos der Fall ist, springt keiner von ihnen aus der Reihe und rennt nach vorne, in Richtung Zukunft. Aber es kommt doch vor, dass man, zum Beispiel bei einem Umzug, eines der Frühwerke in die Hand nimmt und darin blättert. Man wird überrascht von schillernden Denkbildern, die von heute sein könnten. Ansätze und Zusammenhänge, die man einer späteren Phase zugeordnet hätte, oder solche, die man jetzt erst begreift, stehen bereits in den älteren Büchern schwarz auf weiß. Gerade im digitalen Zeitalter, in dem die historischen Rahmen verschwimmen, gefällt mir die Unbestechlichkeit des Papiers, das die Zeit nie schleichend verfälscht. „Yoko Tawada: ARIADNEFÄDEN ALS HARFENSAITEN DES DENKENS“ weiterlesen
Ernst Müller: LAZAR GULKOWITSCHS FRÜHE GRUNDLEGUNG DER BEGRIFFSGESCHICHTE
Die erste Monografie, die sich ausdrücklich und titelgebend mit der »begriffsgeschichtlichen Methode« befasste, stammt von dem jüdischen Religionswissenschaftler Lazar Gulkowitsch (1898–1941). Vier Jahre vor seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten veröffentlichte er 1937 Zur Grundlegung einer begriffsgeschichtlichen Methode in der Sprachwissenschaft in einer deutschsprachigen, der Wissenschaft des Judentums gewidmeten Reihe, die an der Universität Tartu (Dorpat), dem Ort seines estnischen Exils, erschien.[1] Obwohl sich in den letzten Jahren verschiedene Publikationen Gulkowitsch und seinem Werk widmeten,[2] ist seine Schrift zur Begriffsgeschichte selbst dem Fachpublikum dieser geisteswissenschaftlichen Methode unbekannt geblieben, ebenso wie die zahlreichen Untersuchungen, in denen er die Begriffsgeschichte auf den Begriff ›Chassid‹ (Frommer) sowie den Chassidismus[3] anwandte. Gulkowitsch entwickelte dort an Konzepten der jüdischen Geistesgeschichte eine speziell auf die Geschichte des Judentums bezogene Theorie der Begriffsgeschichte, die aber zugleich mit dem Anspruch einer universalistischen Metatheorie der Geistesgeschichte für verschiedene Kulturen antrat. „Ernst Müller: LAZAR GULKOWITSCHS FRÜHE GRUNDLEGUNG DER BEGRIFFSGESCHICHTE“ weiterlesen