›Biodiversität‹ ist ein Schlüsselbegriff unserer Zeit, auf dem Forschungsprogramme, ethische Debatten zum Mensch-Natur-Verhältnis und politische Aktivitäten basieren. In der öffentlichen und politischen Kommunikation funktioniert der Begriff offenbar gut. Er transportiert Achtung und Verantwortung für die Natur, Toleranz gegenüber dem Fremden, Freude an der Heterogenität und Mannigfaltigkeit. Biodiversität steht parallel zur kulturellen Vielfalt und passt in unsere durch Pluralismen geprägte Gegenwart. Denn der Begriff drückt nicht nur Enthierarchisierung und Pluralisierung der Perspektiven aus, Verzicht auf eine übergreifende, durchgängig gültige Ordnung und den Eigensinn und Eigenwert jedes einzelnen, auch nichtmenschlichen Wesens. Er steht auch für das Zusammenführen von wissenschaftlichen mit ethischen, ästhetischen und ökonomischen Aspekten eines Gegenstands und für die Hoffnung auf den letztlich harmonischen Zusammenklang des vielstimmigen Mit- und Gegeneinanders.
Der Neologismus ›Biodiversität‹ entstand Mitte der 1980er Jahre; als richtungweisend gilt das »National Forum on BioDiversity«, das im September 1986 in Washington D. C. stattfand. Urheber des Begriffs ist der Botaniker Walter G. Rosen, dem es darum ging, das ›Logische‹ aus der ›biologischen Diversität‹ herauszukürzen, um Raum für spirit und emotion zu schaffen. ›Biodiversität‹ wurde seitdem zu einem Leitbegriff lokaler und globaler Initiativen zum Schutz der Natur, er bezeichnet Sammlungs- und Ausstellungsstrategien von Naturkundemuseen, wissenschaftliche Forschungsprogramme und vieles mehr. Der Begriff kann dabei sowohl an eine weit zurückreichende wissenschaftliche Tradition anschließen als auch reiche außerwissenschaftliche Bezüge aufnehmen – allen voran Bilder vom Paradies als einer ebenso mannigfaltigen wie harmonischen Welt. Diese Bezüge erklären überhaupt erst den gegenwärtigen Erfolg des Konzepts.
In unserer kulturellen Tradition erscheint die Vielfalt der Lebewesen meist unmittelbar als schön und wertvoll. So weit reicht die Wertschätzung dieser Vielfalt, dass sie zum zentralen Charakteristikum der Idealvorstellung von der Welt, dem biblischen Paradies, wurde. Und die erste Handlung Adams darin war das Benennen der Tiere, die ihm Gott der Reihe nach vorführte. Benennen und Zählen sind indessen elementare Operationen, mit denen der Mensch der Diversität nicht erst in der Bibel begegnet. Bereits unter den ersten menschlichen Schriftzeugnissen überhaupt, verfasst vor 5.000 Jahren in einer mesopotamischen Keilschrift, finden sich Listen von Bäumen, Haustieren, Vögeln und Fischen. Seit dieser Zeit ist das Studium der Diversität also eine Listenwissenschaft: Ihre bevorzugte Darstellung ist die reihende, eindimensionale Ordnung von Elementen auf gleichem Abstraktionsniveau nach dem Prinzip der Ranggleichheit.
Die Lebenswissenschaften traten im Grunde schon immer als Anwalt der Diversität auf. In der Frühen Neuzeit als ›Naturgeschichte‹ entstanden, machten sie sich zunächst daran, die Vielfalt in ihrer ganzen bunten Fülle zu sammeln, zu beschreiben und zu ordnen. Das Ergebnis waren die großen enzyklopädischen Kompendien der Naturgeschichte von den ›Kräuterbüchern‹ und Gesners großer Tierkunde des 16. Jahrhunderts über Linnés System der Natur und Buffons Naturgeschichte bis hin zu Brehms Illustrirtem Thierleben und Grzimeks Tierleben. Das Anordnungsprinzip all dieser Enzyklopädien ist die reine Nebenordnung, die parataktische Aufzählung, anfangs alphabetisch geordnet, später bevorzugt nach dem »natürlichen System«, aber dennoch eines nach dem anderen. Jedes Wesen wird in seinen Eigenfarben und seiner Eigenlogik dargestellt, der Mensch meist eingeschlossen und damit eingereiht (nur nicht bei Gesner und Brehm).
Verstärkt wird diese Betonung der Vielfalt paradoxerweise durch die große vereinheitlichende Theorie der Biologie. Denn für Darwins Evolutionstheorie sind Vielfalt und Variation zentral. Sie bilden die Voraussetzung für die Veränderung der Organismen – keine Selektion ohne Variation –, und sie sind das Ergebnis des jahrmilliardenlangen Differenzierungsprozesses der Evolution. Gegenwärtig ist die Erde von einer unermesslichen Anzahl lebender Individuen besiedelt. Zählt man Bakterien mit, bewegt sich diese Zahl in der gigantischen Größenordnung von 1030; das ist millionenfach mehr, als es Sterne im Universum oder Sandkörner auf der Erde gibt. Auch die Anzahl der Ähnlichkeitsklassen, in die die Biologie ihre Gegenstände gliedert, ist um viele Dimensionen größer als die der Physik und Chemie. Allein die Anzahl der Arten in der Erdgeschichte wird auf 1010 geschätzt, von denen 99,9 % – und damit nach einem Paläontologenwitz in guter Näherung alle – schon wieder ausgestorben sind. Aber bei der Diversität geht es nicht nur um Zahlen. Es geht um qualitative Verschiedenheit, um eine irreduzible Pluralität von Bauplänen und Umwelten, Lebensweisen und Weltentwürfen.
Der Vorzug der reihenden, parataktischen Darstellungsweise, die gleichberechtigte, egalitäre Repräsentation jedes Typs von Wesen, enthält gleichzeitig ihr Problem: Denn wie lässt sich von ihr anschaulich erzählen, wie ein Spannungsbogen erzeugen? Die parataktische Ordnung als Prinzip der Darstellung von Diversität betont gerade die Vielfalt in ihrer Irreduzibilität auf nur eine Perspektive. Narration und Diversität erscheinen somit geradezu als gegensätzliche Ordnungslogiken. Trotzdem wurde und wird von Diversität erzählt.
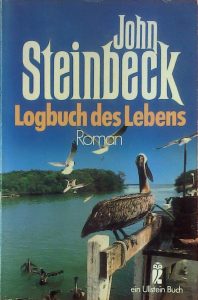 Ein Roman, der als Erzählung von biologischer Diversität gelten kann, ist The Sea of Cortez von John Steinbeck und dem Meeresbiologen Ed Ricketts. Das Buch, 1941 erschienen, berichtet von einer Schifffahrt auf einem kleinen Boot im Golf von Kalifornien. Das Ziel der Reise: Meerestiere sammeln und klassifizieren. Erzählt wird die Vorbereitung der Schifffahrt und der Besuch von 21 festgelegten Stationen, bei denen alle auffindbaren Tiere erfasst werden. Die Erzählung schwelgt in dem Reichtum der Tiere in dieser Region. Die Rede ist von »Überschwang« und »Überfluss«, von »Fülle« und »Reichtum«. Die Fülle wird mit Vollständigkeit in Verbindung gebracht und als subjektive Erfüllung erlebt. Der Bericht von der Begegnung mit dieser Fülle ist bereits die ganze Handlung. Zu Recht trägt das Werk daher in einer zweiten Auflage von 1951 den Titel The Log from the Sea of Cortez, in der deutschen Übersetzung von 1953 Logbuch des Lebens. Steinbeck und Ricketts liefern selbst abstrakte Charakterisierungen ihrer Sicht auf diese Fülle des Lebens: Es geht ihnen um ein, wie sie es nennen, »nicht-teleologisches« oder »Ist-Denken«, das sich nicht nur von der »Ursache-Wirkungs-Methode« und der Hinordnung allen Geschehens auf erwünschte Zielzustände befreit, sondern gleich ganz von dem hypothetischen Denken, wie etwas sein könnte. Stattdessen beschränkt es sich auf die Darstellung, wie etwas ist, auf das Was anstelle des Warum.
Ein Roman, der als Erzählung von biologischer Diversität gelten kann, ist The Sea of Cortez von John Steinbeck und dem Meeresbiologen Ed Ricketts. Das Buch, 1941 erschienen, berichtet von einer Schifffahrt auf einem kleinen Boot im Golf von Kalifornien. Das Ziel der Reise: Meerestiere sammeln und klassifizieren. Erzählt wird die Vorbereitung der Schifffahrt und der Besuch von 21 festgelegten Stationen, bei denen alle auffindbaren Tiere erfasst werden. Die Erzählung schwelgt in dem Reichtum der Tiere in dieser Region. Die Rede ist von »Überschwang« und »Überfluss«, von »Fülle« und »Reichtum«. Die Fülle wird mit Vollständigkeit in Verbindung gebracht und als subjektive Erfüllung erlebt. Der Bericht von der Begegnung mit dieser Fülle ist bereits die ganze Handlung. Zu Recht trägt das Werk daher in einer zweiten Auflage von 1951 den Titel The Log from the Sea of Cortez, in der deutschen Übersetzung von 1953 Logbuch des Lebens. Steinbeck und Ricketts liefern selbst abstrakte Charakterisierungen ihrer Sicht auf diese Fülle des Lebens: Es geht ihnen um ein, wie sie es nennen, »nicht-teleologisches« oder »Ist-Denken«, das sich nicht nur von der »Ursache-Wirkungs-Methode« und der Hinordnung allen Geschehens auf erwünschte Zielzustände befreit, sondern gleich ganz von dem hypothetischen Denken, wie etwas sein könnte. Stattdessen beschränkt es sich auf die Darstellung, wie etwas ist, auf das Was anstelle des Warum.
In diesem dokumentierenden Blick liegt eine Renaissance der Naturgeschichte im Sinne eines Wissens von den Einzeldingen der Natur, das nicht erklärungs- oder begründungsorientiert vorgeht, sondern einfach das Besondere beschreibt. Ihre Einheit gewinnt die Beschreibung nicht aus dem Material selbst, sondern aus der pragmatischen Begrenztheit einer Reise. Darin wirkte Steinbecks Logbuch stilprägend, besonders für das kompensatorisch zum Aussterben von Tierarten aufblühende Genre der Literatur, das von diesem berichtet, wie etwa der Klassiker Last Chance to See (1990, dt. Die Letzten ihrer Art) von Douglas Adams und Mark Carwardine, ein über mehrere Stationen des Reisens verlaufendes melancholisches Erzählen vom Verlust. Die ethische Aufladung der Biodiversität und die ästhetischen Formen, in denen davon erzählt wird, sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern an der Konstitution des Gegenstands beteiligt. Sie machen deutlich, dass Biodiversität von emotion und spirit erfüllt ist.
Diese synthetisierende Kraft des Konzepts, die Tatsachenbeschreibung und Wertungen miteinander verknüpft, ist nicht nur eine Stärke, sondern auch eine Schwäche. Darauf hat die Kritik der letzten Jahre wiederholt hingewiesen: Die Integrationskraft des Begriffs verschleiert, wie notwendig es ist, die wissenschaftliche Begründung von der öffentlichen Bewertung des Wissens zu trennen. Bemerkt wird auch, dass wir in der Natur keineswegs immer die Vielfalt schätzen, traditioneller Naturschutz vielmehr oft auf artenarme Lebensräume oder einzelne Lebensformen gerichtet ist, die ein Landschaftsbild prägen oder für die Integrität eines Systems von besonderer Bedeutung sind. Die Vielfalt als solche ist also noch kein Gut, sondern erst ihr rechtes Maß am rechten Ort. Biodiversität erscheint damit als eine Größe, die aus manchen Überlegungen zum Naturschutz gerade herausgekürzt werden könnte. Fraglich wird mit dieser Kritik schließlich auch die vermeintliche Wertfreiheit in der dokumentierenden Erfassung und gleichberechtigt nebenordnenden Darstellung der Biodiversität. Der unhierarchische, parataktische Egalitarismus vieler moderner Biodiversitätsinstallationen (wie der »Biodiversitätswand« im Berliner Museum für Naturkunde) ist doch kein beschreibendes, authentisches Naturbild, sondern eher die Naturalisierung eines politischen Ideals.
Der Philosoph und Biologe Georg Toepfer leitet seit 2017 gemeinsam mit Stefan Willer am ZfL den Forschungsschwerpunkt »Lebenswissen«. Dieser Beitrag wurde ursprünglich für das Faltblatt zum Jahresthema »Diversität« verfasst.
VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: Georg Toepfer: Biodiversität, in: ZfL BLOG, 5.5.2017, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2017/05/05/georg-toepfer-biodiversitaet/].
DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20170505-01


