Die Zucht der Wissenschaft und die Kriegsbeuten der Literatur
Anders als die Wissenschaft darf die Literatur mit historischen Stoffen einen denkbar freien Umgang pflegen. Schließlich steht sie beinahe schon in der Pflicht, diese immer auch zu aktualisieren. Wo etwa der Historiker sich einer (und sei es fantasmatischen) Objektivität verschreibt, er seine Gegenstände um ihrer selbst willen ordnet, verknüpft und sie behutsam auf Möglichkeiten einer kohärenten Entwicklung hin abklopft, darf der Schriftsteller den Laden der Geschichte hemmungslos plündern. Grundsätzlich stellt er die Vergangenheit in den Dienst der Darstellung zeitgenössischer Konstellationen oder Konflikte. Dies gilt in herausragender Art für literarische Anverwandlungen des Dreißigjährigen Kriegs (1618–1648).
So spielte bereits Friedrich Schiller in seiner Dramentrilogie um Wallenstein von 1799 genuin legitimationspolitische Probleme des späten 18. Jahrhunderts durch und antizipierte im Gewand des böhmischen Feldherrn u.a. Napoleon. Kein Wunder also, dass Schillers literarischer Wallenstein zu dem Wallenstein seiner eigenen historischen – mithin ›wissenschaftlichen‹ – Schrift über den Dreißigjährigen Krieg kaum noch Berührungspunkte aufweisen konnte. In der Weimarer Republik wiederum entwarf Alfred Döblin in einem stilistisch arg überkandidelten Wallenstein-Roman am Beispiel des Herzogs von Friedland ein Herrschaftsmodell, das frappierende Ähnlichkeiten mit der Militärdiktatur Erich Ludendorffs aufwies. Und in den späten 1930er Jahren versuchte sich Bert Brecht in den Trümmern des Dreißigjährigen Kriegs mit seiner Mutter Courage den Zweiten Weltkrieg in kapitalismuskritischer Perspektive auszumalen.
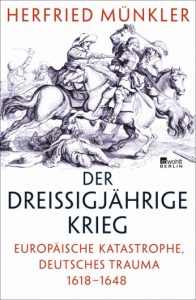 Liest man vor diesem Hintergrund das ambitionierteste deutschsprachige Buch, das bislang zum Gedenkjahr 2018 über den Dreißigjährigen Krieg erschienen ist – Herfried Münklers umfangreiche politikwissenschaftliche Studie Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma 1618–1648 (Berlin: Rowohlt 2017, 974 S.) –, wird man sich zunächst überrascht sehen, dass er die gängige Arbeitsteilung zwischen Literatur und Wissenschaft in Sachen Gegenwartsbewältigung regelrecht auf den Kopf stellt. Münkler erblickt just die wissenschaftliche Bedeutung des Dreißigjährigen Kriegs in den erschreckenden Parallelen, die er zu den derzeitigen Kriegen im Nahen Osten und in Nordafrika erkennen lasse.
Liest man vor diesem Hintergrund das ambitionierteste deutschsprachige Buch, das bislang zum Gedenkjahr 2018 über den Dreißigjährigen Krieg erschienen ist – Herfried Münklers umfangreiche politikwissenschaftliche Studie Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma 1618–1648 (Berlin: Rowohlt 2017, 974 S.) –, wird man sich zunächst überrascht sehen, dass er die gängige Arbeitsteilung zwischen Literatur und Wissenschaft in Sachen Gegenwartsbewältigung regelrecht auf den Kopf stellt. Münkler erblickt just die wissenschaftliche Bedeutung des Dreißigjährigen Kriegs in den erschreckenden Parallelen, die er zu den derzeitigen Kriegen im Nahen Osten und in Nordafrika erkennen lasse.
Übungsplatz statt Antiquität
Münkler verwahrt sich ausdrücklich gegen eine selbstzufriedene Spezialforschung, die dem Dreißigjährigen Krieg nur noch ein »antiquarisches Interesse« (21) zu entlocken vermag, und er mobilisiert sogar die Kantische Ästhetik, wenn er seine Beschäftigung mit dem Thema gerade nicht auf ein »interesseloses Wohlgefallen«, sondern auf die »politischen Herausforderungen der Gegenwart« (820) zu gründen versucht. Münkler lässt solche ›Herausforderungen‹ auf die ›neuen‹ Kriege der letzten Jahre und Jahrzehnte zwar zulaufen, sie in ihnen aber keineswegs vollständig aufgehen.[1] Sein dezidiert gegenwärtiger Blick auf den Dreißigjährigen Krieg ist viel grundsätzlicher, weil dieser wie kaum ein anderer dazu geeignet sei, »dem gravierenden Defizit an strategischem Denken in der politisch interessierten deutschen Öffentlichkeit« (37) abzuhelfen. Der Dreißigjährige Krieg bilde einen »vorzügliche[n] Übungsplatz für strategisches Denken« (39). Münkler lässt keinen Zweifel daran, dass ein solcher ›Übungsplatz‹ heute dringend nottut, und dass er auch im 17. Jahrhundert bereits dringend notgetan hätte. Denn dass die Gewalt seinerzeit komplett aus dem Ruder laufen und der Krieg sich regelrecht verselbständigen konnte, resultiere auch aus einem zunehmenden »Verlust strategischer Ziele« (551).
Hier mögen zum einen Carl Schmitts Forderungen nach (vermeintlich) unideologischen und sauber ›eingehegten‹ Kriegen Pate stehen, zum anderen holt Münkler sein Ansinnen nicht anhand rechtsontologischer, sondern anhand militärischer und politischer Kategorien ein. Bezeichnenderweise denkt er denn auch durchgehend lieber mit Clausewitz als mit Schmitt.
Der intellektuelle Reiz seines Buchs besteht darin, das gesamte Kriegsgeschehen des frühen 17. Jahrhunderts auf analytischer Ebene tatsächlich in einen strategischen ›Übungsplatz‹ verwandelt und mittels der Anleitung zur strategischen Einsicht doch nichts Geringeres als eine Gesamtdarstellung des Dreißigjährigen Kriegs erbracht zu haben. Folglich lässt sich die Studie mühelos auch als Einführung in ihren höchst verwickelten Gegenstand lesen, denn den einschlägigen Begebenheiten, Umständen und Akteuren räumt sie noch einmal breiten Raum ein: dem Jülicher Erbfolgestreit und dem Prager Fenstersturz; den ewigen religiösen, konfessionellen und innerprotestantischen Querelen im Vorfeld wie im Verlauf des Kriegs; der Zerstörung Magdeburgs und der Verwüstung unzähliger anderer Städte und Dörfer; den großen Feldherren von Tilly, Mansfeld und Christian von Braunschweig über Wallenstein und Gustav Adolf bis hin zu Torstensson und Bernhard von Weimar; dem Söldnerwesen und dem Geld als »nervus rerum des Krieges« (148); dem unseligen hegemonialen Machtgefüge zwischen Spanien, Frankreich und Heiligem Römischen Reich Deutscher Nation ebenso wie den verfassungsrechtlichen und machtpolitischen Interessenskonflikten zwischen Kaiser und deutschen Kurfürsten; den bürgerkriegsähnlichen und wiederholt aufflammenden Bauernaufständen; dem Regensburger Fürstentag und dem gescheiterten Prager Frieden; den den Krieg obligat begleitenden Krankheiten und Seuchen; ja selbst den literarischen und künstlerischen Bearbeitungen der Gewalt bei Grimmelshausen, Gryphius, Paul Gerhardt, Velázquez, Rubens, Callot oder Hans Ulrich Franck.
Der Wissenschaftler als Feldherr und Stratege
Zu den narrativen Höhepunkten des Buches gehören dabei weit ausholende Beschreibungen der großen Schlachten am Weißen Berg, in Breitenfeld, Lützen, Wittstock oder Nördlingen, in denen Münkler sich nicht scheut, den berüchtigten panoramatischen Feldherrenblick einzunehmen und diesen mit der tendenziellen Blindheit des einfachen Soldaten verschiedentlich doch explizit zu flankieren (vgl. 494f.). Selbstverständlich erfahren die Leser alles Nötige auch über militärhistorische und technische Entwicklungen, von der Rolle mathematischer Berechnungen im Kontext einer grundsätzlichen »Verwissenschaftlichung des Kriegs« (201) insbesondere bei der Belagerung von Festungen oder Städten bis hin zum Aufkommen der Dragoner als neuer Kampfspezies.
Es ist aber erst das strategische Paradigma, mit dem Münkler Ordnung auch dort in das verflochtene Geschehen bringt, wo eine solche den zeitgenössischen Akteuren größtenteils verborgen geblieben war. Er unterscheidet wiederholt drei Kriegstypen, die im Dreißigjährigen Krieg in je unterschiedlicher Dichte interagieren und die seinen Verlauf oder sogar seine Phasen unterschiedlich strukturieren: den Verfassungskonflikt des Alten Reichs, den Hegemonialkrieg zwischen den damaligen Großmächten und den Religionskrieg. Mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Rahmen von Plünderungen, Belagerungen oder Aufständen kommt sporadisch sogar ein vierter Kriegstypus hinzu.
Wenn Münkler gegen Ende seines Buches feststellt, die »erste Herausforderung« des Westfälischen Friedens habe darin bestanden, »diese unterschiedlichen Kriegstypen und diversen Kriegsebenen voneinander zu trennen und so zu ordnen, dass sie verhandelbar wurden« (793), besteht eine schöne Pointe seiner Untersuchung darin, dass die Osnabrücker und Münsteraner Gesandten nun endlich dort ankommen, wo Münkler seit Beginn der Kampfhandlungen bereits war. Genau besehen hat er seinen Lesern den gesamten Kriegsverlauf als ›Westfale‹ vor Augen gestellt, denn eine saubere Entwirrung der genannten Ebenen bildet die Voraussetzung sowohl des Westfälischen Friedens als auch der eigenen kriegsstrategischen Lektionen.
Die Fehler der Akteure und das Problem der Kontingenz
Diese Lektionen erteilt Münkler unter anderem, indem er den Akteuren wiederholt strategische Fehler nachweist, die für sie selbst wie für das gesamte Kampfgeschehen verheerende Konsequenzen zeitigen sollten. So hätten die in dem berüchtigten Restitutionsedikt des Kaisers gipfelnden umfassenden Rekatholisierungsbestrebungen Habsburgs auf dem Höhepunkt seiner Macht zugleich bereits seinen Verfall eingeleitet und »die Transformation militärischer Erfolge in politische Stabilität verhindert« (378). Auch die Schweden um Gustav Adolf sieht Münkler nach ihrem glänzenden Sieg in Breitenfeld in einem »politisch-strategischen Dilemma« (511), weil ihnen der »Zweck« der eigenen Kriegsführung – eine schwedische Vormacht an der Ostsee oder die Anführung des deutschen Protestantismus – von Anfang an nicht vollends klar gewesen sei. Und mitunter erregen auch militärische Operationen im engeren Sinn Münklers strategisches Missfallen; Lützen etwa nennt er ungeniert eine »taktisch uninspirierte Schlacht« (587).
Eine Art Ableger der strategischen Reflexion stellen Münklers Überlegungen zur Kontingenz und zu alternativen Handlungsverläufen des Krieges dar. So betrachtet er bereits dessen Ausbruch als »keineswegs unvermeidlich« (119) und die traditionelle Unterscheidung zwischen ›Ursache‹ und ›Anlass‹ als falsche Suggestion. Die Interpretationen einer »Zwangsläufigkeit des Kriegs und die seiner Kontingenz« stünden »nebeneinander, und es ist kaum möglich zu begründen, warum die eine der anderen überlegen sein soll« (120). Beide »relativiert[en]« zudem unsinnigerweise die »Bedeutung von Entscheidungen« (ebd.). Die Dimension der politischen wie militärischen ›Entscheidung‹ systematisch zurückgewonnen und sie vor strategischem Hintergrund konsequent abgewogen zu haben, stellt das unbestreitbare Verdienst von Münklers Studie dar. Ihr Ziel einer »Schulung der politischen Urteilskraft« (ebd.) löst sie auf diese Art vollumfänglich ein. Über den permanenten Aufweis von Optionen, Alternativen, Fehlentscheidungen und verpassten Chancen bringt Münkler die Totalität des Geschehens in den Blick und gewinnt im Diskurs der Wissenschaft so etwas wie den analytischen Oberbefehl über den Dreißigjährigen Krieg.
Westfalen und seine Grenzen
Doch dass Münkler diesen Oberbefehl immer schon aus ›westfälischem‹ Geist gewinnt, macht seine Überlegungen vor allem zu den Parallelen von Dreißigjährigem Krieg und heutigen Kriegen im Nahen Osten und in Nordafrika angreifbar. Zwar verfährt er mit territorialen und politischen Analogiebildungen – etwa zwischen Libyen und Böhmen – behutsam (vgl. 827) und warnt selbst unablässig vor vorschnellen Identifikationen. Insofern kann man seinen Begriff des strategischen ›Übungsplatzes‹ in den Ausführungen gerade zu den heutigen Kriegen gar nicht ernst und wörtlich genug nehmen. Es bleiben gleichwohl die von ihm selbst sorgfältig herauspräparierten Kriegstypen, die eine Verbindung zwischen Dreißigjährigem Krieg und ›neuen‹ Kriegen sowohl nahelegen als auch konterkarieren.
Denn zu spezifisch waren wohl doch die Verfassungsprobleme des Alten Reichs und zu stark haben sie das Verhältnis zwischen Hegemonial- und Religionskriegen im 17. Jahrhundert geprägt, als dass sie sich über vierhundert Jahre später in anderen kulturellen und politischen Konstellationen wiederfinden lassen könnten. Und so schlüssig die Unterstellung einer fatalen Verwicklung von Religions-, Hegemonial- und Bürgerkriegen mit Blick auf den Vorderen Orient auf den ersten Blick sein mag: ›Religion‹ ist nun einmal nichts anderes als eine genuin europäische, streng genommen sogar eine genuin aufklärerische Abstraktion. Damit werden sich Politik und ›Religion‹ außerhalb des ›Westens‹ auch nicht ohne weiteres entflechten lassen. Die Apologie einer strategischen Urteilskraft, die auf exakt dieser ›Entflechtung‹ beruht, droht hier schlechterdings ins Leere zu laufen. Aleppo oder Kabul sind keine Stadtteile von Osnabrück.
Solche Einwände sind freilich banal und fallen hinter Münklers politische, militärische wie strategische Raffinesse zurück. Denn er mutmaßt ganz richtig, dass es nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch Unterschiede zwischen vergangenen und heutigen Kriegen sind, aus denen sich analytisches Kapital lässt (vgl. 843); und fulminant gezeigt hat er damit einhergehend fraglos auch, dass der Dreißigjährige Krieg nicht allein den Blick für die Gegenwart schärft, sondern dass heutige Kriege auch umgekehrt noch einmal wesentlich zu einem präziseren Verständnis des Dreißigjährigen Kriegs beitragen können (vgl. 826). Das Bewusstsein dafür, dass strategisches Denken im Kriegsfall allemal sinnvoller ist als jede Form einer »unbedingten Wertbindung« (38), wird man spätestens nach der Lektüre seiner Studie kaum noch ernsthaft bestreiten können.
Das Kreuz mit der Strategie
Einerseits. Andererseits unterstellt Münkler dem strategischen Denken an sich bereits potentiell disziplinierende Wirkungen, die seine eigene Untersuchung nicht immer beglaubigen kann. Denn es hat im Dreißigjährigen Krieg an strategischen Meisterdenkern nicht gefehlt. Der versierteste dürfte Kardinal Richelieu gewesen sein, der politische von religiösen Interessen durchaus zu trennen vermochte, der als Regent des katholischen Frankreich den Krieg zwischen dem Kaiser und Schweden kräftig anheizte und sich auf die Seite des religiösen Feindes schlug, um die politische Prädominanz Habsburgs zu brechen. In die Nähe Richelieus rückt Münkler unter strategischen Gesichtspunkten faszinierenderweise und völlig überzeugend unzählige militärische wie politische Überlegungen ausgerechnet Wallensteins, und im Fall der Brandschatzung Magdeburgs konzediert er sogar, dass der General Tilly das schlimmste Massaker des ganzen Kriegs ebenfalls als »Strategem« (326) eingesetzt haben könnte.
Auch wenn die Genannten den Krieg – anders als Münkler in seiner wissenschaftlichen Kommandozentrale – niemals als Ganzes in der Hand hatten, darf man an einer gewaltkanalisierenden Funktion von Strategie punktuell somit auch zweifeln. So wie sich im 17. Jahrhundert der Krieg verselbständigt hatte, so verselbständigt sich bei Münkler streckenweise vielleicht der Glaube an einen (zu) kategorischen Sinngehalt der strategischen Vernunft. Zugute halten muss man ihm wiederum, dass er derart fundamentale Fragen aus dem Horizont seiner Studie nicht verbannt, sondern sich ihnen (selbst unterschwellig) permanent aussetzt.
Wissenschaftliche Totenmemoria
Es gibt in Münklers Buch aber auch noch andere, beinahe schon literarische Schichten. Obwohl er weder anthropologisch noch ethisch oder metaphysisch jemals ins Gefühlige abstürzt und seine Urteile wie seine Sprache immer kristallklar bleiben, setzt er unbekannten Toten mitunter bescheidene Denkmäler. So nennt er etwa die Namen zumindest vierer der insgesamt acht toten Kinder, die er den viel beachteten Tagebuchaufzeichnungen des Söldners Peter Hagendorf entnimmt (vgl. 689). Auf diese Art verhilft er den im Krieg gestorbenen Kindern Hagendorfs im wissenschaftlichen Diskurs zu einer Art Grab. Die Grablegung von Kriegstoten, die in der Regel keinen Friedhof und keinen Ort hatten, gehört nun seit alters her zu den herausragenden Aufgaben der literarischen Tradition. Es bleibt abzuwarten, in welchem Maß und mit welchen Intentionen auch sie sich des Dreißigjährigen Kriegs vierhundert Jahre nach seinem Beginn und dreihundertsiebzig Jahre nach seinem Ende noch einmal annehmen wird.
[1] Vgl. hierzu grundlegend auch Herfried Münkler: Die Neuen Kriege, 3. Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2007.
Der Germanist Claude Haas leitet seit 2017 am ZfL das Forschungsprojekt Theoriebildung im Medium von Wissenschaftskritik.
VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: Claude Haas: Zur Aktualität des Dreißigjährigen Krieges (I): Übungsplatz für strategisches Denken – Herfried Münklers Studie »Der Dreißigjährige Krieg«, in: ZfL BLOG, 4.4.2018, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2018/04/04/claude-haas-zur-aktualitaet-des-dreissigjaehrigen-krieges-i-uebungsplatz-fuer-strategisches-denken-herfried-muenklers-studie-der-dreissigjaehrige-krieg/].
DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20180404-01

