Städte sind in einem fortwährenden Wandel begriffen, Aufbau und Zerstörung gehen Hand in Hand. Was bleibt, sind urbane Landschaften, in denen sich die Zeitläufte mal mehr, mal weniger sichtbar sedimentieren; Straßen, Häuser und eine ausdifferenzierte Infrastruktur, die uns Orientierung im urbanen Raum verschaffen. Zwei Bücher aus dem Verlag Klaus Wagenbach beschäftigen sich anhand konkreter Gestaltungsfragen mit den Veränderungen unserer städtischen Umgebung. Marmor und Asphalt. Soziale Oberflächen im Berlin des 20. Jahrhunderts (2018), ein Buch der Hamburger Kunsthistorikerin Monika Wagner, widmet sich auf originelle Weise speziell der Berliner Stadtlandschaft: »Gegenüber der Formgeschichte und dem Interesse an Strukturmerkmalen«, so Wagner über ihren Ansatz, »stehen vielmehr Beobachtungen alltäglicher Symptome im öffentlichen Raum der Stadt zur Debatte« (S. 11).
 Komplementär dazu lässt sich das Buch des Architekten und Städtebauhistorikers Vittorio Magnago Lampugnani lesen, Bedeutsame Belanglosigkeiten. Kleine Dinge im Stadtraum (2019). Am Beispiel von – wie er es nennt – »Mikroarchitekturen« (etwa der Telefonzelle), »Objekten« (darunter der Abfallkorb und das Straßenschild) und »Elementen« (z. B. Schaufenstern) schärft er das Bewusstsein für die Vielfältigkeit unserer urbanen Umwelt. Sein Buch ist als ein Glossar angelegt, dessen Geschichten hinter den »kleinen Dingen« einander ähneln: Aus einer praktischen Notwendigkeit, die sich aus einer veränderten sozialen oder technologischen Situation ergibt (Industrialisierung, Aufschwung von Handel und Kommerz, Entwicklung neuer Verkehrs- und Kommunikationsmittel), entsteht etwas Neues, dessen Verbreitung in der Stadt – in der Regel – von den Kommunen finanziell zu stemmen ist:
Komplementär dazu lässt sich das Buch des Architekten und Städtebauhistorikers Vittorio Magnago Lampugnani lesen, Bedeutsame Belanglosigkeiten. Kleine Dinge im Stadtraum (2019). Am Beispiel von – wie er es nennt – »Mikroarchitekturen« (etwa der Telefonzelle), »Objekten« (darunter der Abfallkorb und das Straßenschild) und »Elementen« (z. B. Schaufenstern) schärft er das Bewusstsein für die Vielfältigkeit unserer urbanen Umwelt. Sein Buch ist als ein Glossar angelegt, dessen Geschichten hinter den »kleinen Dingen« einander ähneln: Aus einer praktischen Notwendigkeit, die sich aus einer veränderten sozialen oder technologischen Situation ergibt (Industrialisierung, Aufschwung von Handel und Kommerz, Entwicklung neuer Verkehrs- und Kommunikationsmittel), entsteht etwas Neues, dessen Verbreitung in der Stadt – in der Regel – von den Kommunen finanziell zu stemmen ist:
»Jedes kleine Objekt des Stadtraums ist ein Ort, wo konkrete Bedürfnisse zu einer materialisierten Form finden.« (S. 11)
Während Wagner sich ganz auf Berlin konzentriert, beginnt Lampugnani viele seiner lehrreichen Einträge mit einer Rückschau auf die urbanen Zentren der Antike, um dann die Geschichten seiner Gegenstände durch Ausflüge in die europäischen Metropolen zu verfolgen – bevorzugt London, Paris oder eben auch Berlin. Architektur, Ästhetik und Kritik lassen sich bei dieser Form der Stadterkundung nicht trennen, denn »[d]ie kleinen Dinge im Stadtraum sind […] funktional, technisch und ökonomisch bestimmt und haben dabei oft einen hohen gestalterischen Anspruch« (S. 8). Da Lampugnani diesen Anspruch aber mehr und mehr schwinden sieht, verschafft sich in nicht wenigen seiner Einträge am Ende die mahnende Stimme des Kulturkritikers Gehör. Exemplarisch ist in dieser Hinsicht das Fazit seiner Ausführungen zum Kiosk:
»Heute, da es kaum mehr Stadtarchitekten gibt, weil diese Position in der Verwaltung faktisch abgeschafft wird, um der Politik mehr Spielraum zu gewähren, werden Gestaltung und Unterhalt der modernen Kioske privaten Firmen überlassen. Sie achten Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und eine gewisse modische Eleganz; Verantwortung für die Stadt und ihre Identität übernehmen sie nicht.« (S. 23)
So mancher Neuerung steht er deshalb skeptisch gegenüber. Kritik erntet beispielsweise die »Gedankenlosigkeit, mit der heute Bänke im städtischen Raum aufgestellt werden«, was aus seiner Sicht zur Verbreitung von »urbanem Kitsch« (S. 80) beitrage. Bei jeglicher Stadtmöblierung, da ist Lampugnani zuzustimmen, geht es eben nicht nur um Funktionalität und Bedürfnisbefriedigung, sondern auch um ästhetische Fragen, die Auswirkungen auf die spezifische Kultur und Identität konkreter soziale Räume haben. Jedes dieser Dinge, etwa die Straßenlaterne, trägt »städtebauliche Verantwortung« (S. 89). Die Identität einer Stadt wird demnach von langlebigen Objekten (dem Brunnen, dem Straßenschild) ebenso geprägt wie von vergleichsweise kurzlebigen; man denke nur an die grellorangen Straßenmülleimer der Berliner Stadtreinigung mit ihren witzigen Sprüchen, die über die Grenzen der Stadt zu deren frischen Image beigetragen haben. Lampugnanis Ausführungen sind somit nicht frei von normativen Vorstellungen, im Gegenteil. Stadtplaner*innen, Architekt*innen und Kommunalpolitiker*innen täten gut daran, sich eingehender mit ihnen auseinanderzusetzen.
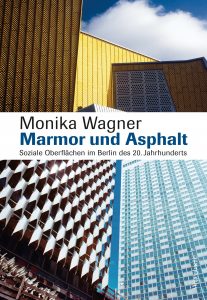 Um Kultur und Identität des städtischen Raums geht es auch bei Monika Wagner. Entlang einiger Beispiele, die ausschließlich dem Berliner Stadtraum entstammen, unternimmt sie »eine historische Rekonstruktion der Produktion, Funktion und Bewertung von Oberflächen sowie der durch sie erzeugten Atmosphären« (S. 11). Die Oberflächen, die sie in den Blick nimmt (Asphalt, Glas, Beton, Naturstein, Keramik usw.), markieren dabei eine Grenze zwischen dem Innenraum der Häuser und ihrem Außen, eine Grenze, mit der die Menschen in der Stadt fortwährend in Berührung geraten. Was eingangs noch ein wenig nüchtern klingt, wird zu einem faszinierenden Parcours durch die jüngere Architekturgeschichte Berlins. Mit dem Aufstieg zu einer Metropole der Moderne in den 1920er Jahren beginnend, widmet sich Wagner im Hauptteil ihres Buches vergleichend der Ausgestaltung von Stalinallee und Hansaviertel, bevor sie abschließend die Friedrichstraße nach dem Fall der Mauer erreicht.
Um Kultur und Identität des städtischen Raums geht es auch bei Monika Wagner. Entlang einiger Beispiele, die ausschließlich dem Berliner Stadtraum entstammen, unternimmt sie »eine historische Rekonstruktion der Produktion, Funktion und Bewertung von Oberflächen sowie der durch sie erzeugten Atmosphären« (S. 11). Die Oberflächen, die sie in den Blick nimmt (Asphalt, Glas, Beton, Naturstein, Keramik usw.), markieren dabei eine Grenze zwischen dem Innenraum der Häuser und ihrem Außen, eine Grenze, mit der die Menschen in der Stadt fortwährend in Berührung geraten. Was eingangs noch ein wenig nüchtern klingt, wird zu einem faszinierenden Parcours durch die jüngere Architekturgeschichte Berlins. Mit dem Aufstieg zu einer Metropole der Moderne in den 1920er Jahren beginnend, widmet sich Wagner im Hauptteil ihres Buches vergleichend der Ausgestaltung von Stalinallee und Hansaviertel, bevor sie abschließend die Friedrichstraße nach dem Fall der Mauer erreicht.
Anhand der nach dem Ersten Weltkrieg vorangetriebenen Asphaltierung der Straßen beschreibt sie die grundsätzliche Ausdifferenzierung der großstädtischen Bevölkerung in Autofahrer und Fußgänger, denen sich die Oberflächen unterschiedlich darstellen. Während die Fußgänger auch weiterhin mit den Oberflächen der Häuser und Straßen in engeren Kontakt kamen (auf dem Gehweg, beim Blick ins Schaufenster), nahmen die Menschen in den Autos Straßenbeläge nur noch vermittelt und die Fassaden der Häuser als rhythmisierte Bewegtbilder wahr. Diese wurden zusätzlich akzentuiert durch Glas und Licht als Elementen einer modernen Architektur, die ihre materiellen Grundlagen zum Verschwinden bringen wollte. Ausführlich bespricht Wagner die Wirkung von Fassadengestaltungen unter den Aspekten Horizontalität und Vertikalität. Sie beruft sich dafür u. a. auf Erich Mendelsohn, verantwortlich für den Umbau des Mossehauses, der die Horizontale mit Demokratie und Freiheit assoziiert, und auf Siegfried Kracauer, der die Vertikale als Ausdruck staatlicher Gewalt interpretiert. Doch erst im komplexen Zusammenspiel der Linien entstehen in der realen Stadt Effekte, die von Bewohner*innen und Besucher*innen abhängig von der jeweiligen historischen Perspektive wahrgenommen werden und differenzierter Interpretationen bedürfen.
Nach dem Krieg und der Teilung Berlins herrschten in Ost und West unterschiedliche Vorstellungen vom öffentlichen Raum, und dabei gerieten auch die Oberflächen zu einem »Schauplatz der Systemkonkurrenz« (S. 12). »Dem öffentlichen Raum der Stadt als Ort staatlicher Repräsentation, sozialer Gemeinschaftsbildung und wechselseitiger Kontrolle kam in der DDR höchste Aufmerksamkeit zu«, schreibt Wagner (S. 70). Sie zeigt dies an der heutigen Karl-Marx-Allee, die im Krieg zerstört und ab 1951 als Stalinallee neu bebaut wurde. Die mehrspurige Fahrbahn, die auch für Aufmärsche herzuhalten hatte, wurde dabei durch monumentale Fassaden gesäumt. Zwar kamen hier überwiegend die gleichen Materialien zum Einsatz, doch die einzelnen Fassaden wurden im Detail unterschiedlich ausgestaltet; dies erschließt sich dem Fußgänger in der Nahsicht aber tatsächlich sehr viel eindrücklicher als dem Autofahrer. Lange Zeit für ihren ›Zuckerbäckerstil‹ verachtet, sind die Wohnhäuser heute wieder extrem angesagt. Im Westteil wurde demgegenüber 1957 das – heute ebenfalls ausgesprochen populäre – Hansaviertel mit seinen freistehenden Hochhäusern inmitten eines durchgrünten Stadtraums präsentiert.[1] So unterschiedlich die beiden städtebaulichen Ansätze auch in politisch-ideologischer Hinsicht waren, sieht Wagner doch Gemeinsamkeiten, was die »erstaunliche Materialvielfalt und die taktilen Angebote« betrifft (S. 95), zumal im Vergleich zum Neuen Bauen der 1920er Jahre mit seinen glatten Oberflächen. In »Einsatz und Gestaltung der Materialien« (ebd.) unterscheiden sich die beiden Vorzeigeprojekte gleichwohl. Überzeugend vertritt Wagner die These, dass in beiden Fällen »Oberflächen aus Naturstoffen und handwerklich verarbeiteten Materialien« geschaffen worden seien, deren Verwendung in Westberlin aber auf eine Integration von modernem Wohnen inmitten gestalteter Natur abgezielt habe, während »die Handwerklichkeit der Oberflächen der Stalinallee […] die Integration in eine Gemeinschaft der Werktätigen« verfolgt habe (S. 110).
Wagner widmet sich überaus anschaulich den Materialien, die den Gebäuden der Stalinallee im Zusammenspiel mit vielfältigen architektonischen Elementen (Balkone, Balustraden, Kolonnaden usw.) abwechslungsreiche Reliefstrukturen verleihen. Anfänglich ließ sich die Opulenz dieser Fassadengestaltung noch als Ausdruck des Reichtums der neuen sozialistischen Gesellschaft deuten, zeugte diese doch nicht zuletzt von großer handwerklicher Kunst. Doch schon bald wollte dieser Stil nicht mehr so recht zur Politik der DDR passen, die an einer stärkeren Industrialisierung des Bauens interessiert war – und deren Verwirklichung dann später in den monotonen Plattenbauten der 1970er Jahre ihren prägnantesten Ausdruck fand. Noch heute bemerkenswert sind die unterschiedlichen Kacheln, die symbolisch »zwischen Tradition und Innovation, zwischen Handwerk und Industrie« (S. 81) stehen. Ihr Ausgangsmaterial Ton, »der ideale Alleskönner«, wird von Wagner als »Scharnier zwischen den materiellen Produktionsbedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, der staatlichen Gemeinschaftsideologie und der Ästhetik des ›kleinen Mannes‹« interpretiert (S. 84). Dies zeigt sich besonders schön auch an den Bildprogrammen, die sowohl auf den Kacheln als auch an skulpturalen Elementen zum Einsatz kommen (etwa den Keramikreliefs am von Richard Paulick gestalteten Block C der Stalinallee, die deren Aufbau illustrieren).
Zur Stützung ihrer übergeordneten These legt Wagner in ihrer Interpretation des Hansaviertels ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Fußgängerwege, deren unregelmäßige Ränder Weg und Grünfläche ineinander übergehen lassen. Ausführlicher betrachtet sie auch den Bau der Akademie der Künste von Werner Düttmann, bei dem u. a. Backstein, Marmorkiesel und Kupfer verwendet wurden:
»Die Materialien betonen ihre Herkunft aus der Natur und evozieren eine scheinbar einfache, handwerkliche Bearbeitung. Damit verstärken sie das Konzept der Stadtlandschaft als Versöhnung von Natur und Moderne.« (S. 109)
Wagners Buch eignet sich hervorragend als Vademecum für ausgedehnte Spaziergänge, sei es durch das Hansaviertel, sei es entlang der Karl-Marx-Allee – oder auch in der neuen Mitte Berlins, wo heute die unterschiedlichsten Architekturstile aufeinandertreffen, in denen das Glatte (Glas, Marmor etc.) und das Raue (etwa Schrottskulpturen, Spolien u. a.) neben- und miteinander angeordnet sind. Hier finden sich städtische Räume – wie etwa die Friedrichstadt-Passagen –, deren Schaffung sich offensichtlich in erster Linie der Logik von Investoren verdankt und weniger urbanistischer Einsicht und Erkenntnis. Beide Bücher tragen dazu bei, derartige Eindrücke zu erklären.
[1] Es ist beispielsweise Schauplatz eines Romans von Helene Hegemann, Bungalow (2018).
Der Sprach- und Kulturwissenschaftler Dirk Naguschewski ist am ZfL zuständig für Wissenstransfer und Kommunikation.
DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20200306-01

