Die Welt hatte im 21. Jahrhundert in den Geisteswissenschaften bislang keinen guten Ruf. Philosophen wie Markus Gabriel verkündeten, es gebe sie gar nicht, sondern nur Anschauungen, Vorstellungen und Begriffe von ihr. Diese – und mit ihnen auch die Welt – gelte es im Sinn eines ›Neuen Realismus‹ endlich ad acta zu legen und im Anschluss an ihre Grablegung »den Grundsatz einer neuen Philosophie [zu] entwickeln«.[1] Demgegenüber leuchteten die Literaturwissenschaften die kulturellen und politischen Implikationen von Welt-Begriffen noch einmal akribisch aus. Anders als im neorealistischen Neubeginn der Philosophie entpuppten sich die Zuschreibungen oder Behauptungen von ›Welt‹ in ihren Analysen jedoch als leere Verheißungen nicht etwa von zu viel, sondern als solche von zu wenig Welt. Wo Welt drauf stand, war nur ein Bruchteil Welt drin.
Beobachten lässt sich das vor allem an den exzessiv geführten Debatten um den Begriff der ›Weltliteratur‹ in den neueren Philologien und in der Komparatistik. ›Weltliteratur‹ erwies sich in ihnen oft als das Projekt einer kulturellen Selbstermächtigung des globalen Nordens.[2] Dieser Befund mag zu gelegentlich wohlfeilen Dämonisierungen geführt haben, von der Hand zu weisen ist er nicht. Anders als die Philosophie kann sich die Philologie die Welt eben nicht machen, wie sie ihr gefällt. Sie hat sich um ihre historischen Imaginationen in unterschiedlichen literarischen Traditionen zu kümmern. Diese sind oft problematisch, sie erschließen sich aber nicht mittels der Dichotomie von ›wahr‹ und ›falsch‹. Umso weniger, als ihre Wirksamkeit von der Erkenntnis ihrer Fragwürdigkeit gar nicht unmittelbar abhängt. Die Aufgabe besteht erst einmal darin, die von der Welt ausgehende Faszinationskraft in ihren kulturgeschichtlichen Kontexten zu verstehen.
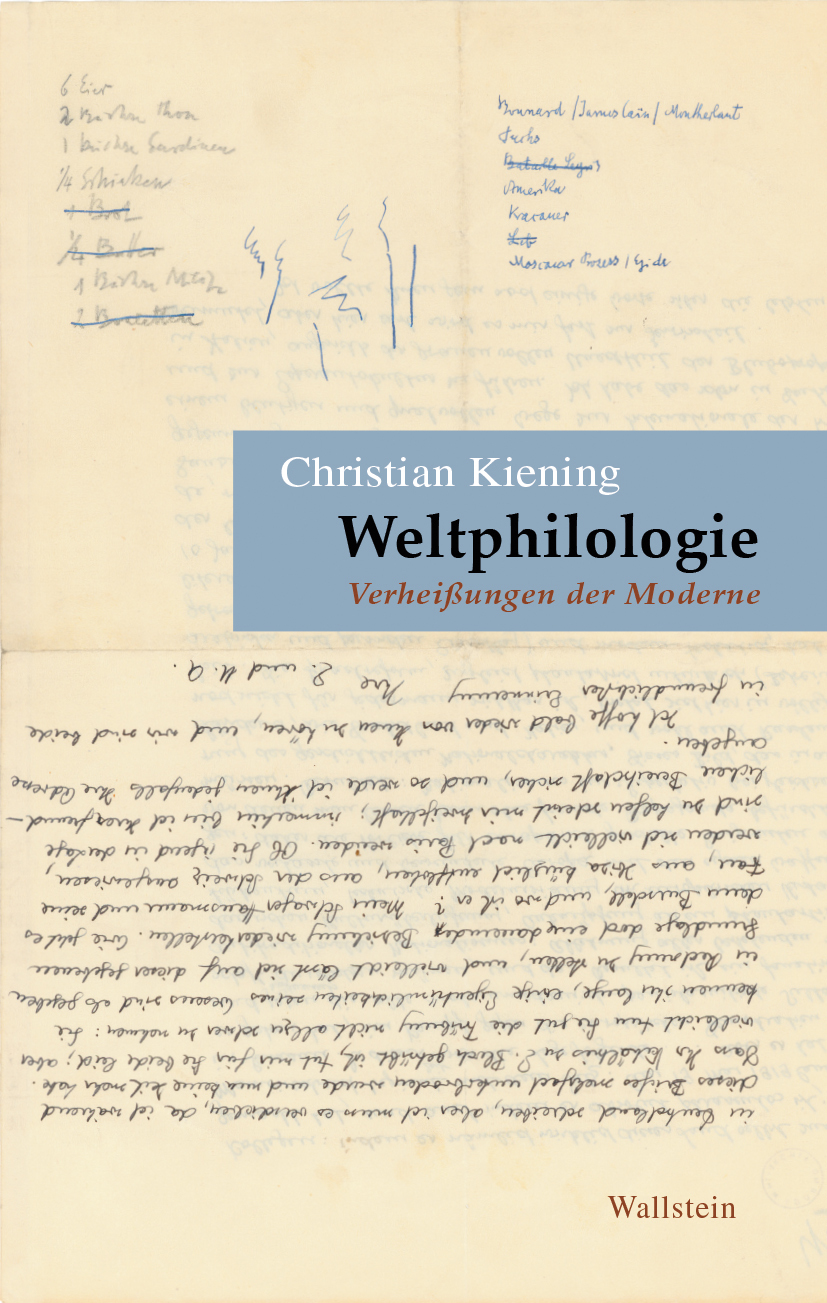 Von dem Bemühen, alten Versprechen von Welt auch dort etwas abzugewinnen, wo sie uns historisch, kulturell, wissenschaftlich oder medial im Einzelnen längst fremd geworden sind, zeugt das neue Buch des Zürcher Mediävisten Christian Kiening. Es trägt den (Ober-)Titel »Weltphilologie«, und tatsächlich sind die Welt und die Weltliteratur zumindest auf den ersten Blick eher indirekte Gegenstände seiner Studie (Christian Kiening: Weltphilologie. Verheißungen der Moderne, Göttingen: Wallstein, 2025). Kiening nimmt vielmehr jene Verfahren ins Visier, die die moderne Philologie nutzt, um Welt und Weltliteratur überhaupt erst zu konstituieren. Diese Verfahren betrachtet er rückblickend trotz vieler Bedenklichkeiten nicht als Irrweg, sondern als Vermächtnis und Chance.
Von dem Bemühen, alten Versprechen von Welt auch dort etwas abzugewinnen, wo sie uns historisch, kulturell, wissenschaftlich oder medial im Einzelnen längst fremd geworden sind, zeugt das neue Buch des Zürcher Mediävisten Christian Kiening. Es trägt den (Ober-)Titel »Weltphilologie«, und tatsächlich sind die Welt und die Weltliteratur zumindest auf den ersten Blick eher indirekte Gegenstände seiner Studie (Christian Kiening: Weltphilologie. Verheißungen der Moderne, Göttingen: Wallstein, 2025). Kiening nimmt vielmehr jene Verfahren ins Visier, die die moderne Philologie nutzt, um Welt und Weltliteratur überhaupt erst zu konstituieren. Diese Verfahren betrachtet er rückblickend trotz vieler Bedenklichkeiten nicht als Irrweg, sondern als Vermächtnis und Chance.
Zu seinen wichtigsten Stichwortgebern gehört Erich Auerbach. Genau wie dieser sieht Kiening die Philologie selbst »am Projekt der Weltliteratur teilhaben« (11). Die Philologie unterhalte zur Welt »ein nicht nur repräsentierendes, sondern auch partizipatives Verhältnis« (13), und genau diese Tendenz verbinde sie mit ihrem Gegenstand, der Literatur. Erzählte und dargestellte Welten besitzen im Idealfall eine solche »Prägnanz«, dass sie »als Wirklichkeit aufgefasst « werden können (11). Anders als der Poststrukturalismus, der interessanterweise genau wie für Markus Gabriel auch für Kiening zu den großen Gegnern gehört, schließt er hieraus aber nicht etwa auf einen fantasmatischen Grundzug jeder dargestellten Welt. Ganz im Gegenteil wird der Weltbegriff auf diese Weise zu einer »verheißungsvollen Kategorie« (17). Er sichere der Philologie »eine besondere Art von Welthaltigkeit, Geltung und Bedeutsamkeit« (ebd.). Es sind in erster Linie die ihnen immanenten Vorstellungen von ›Welthaltigkeit‹, auf die Kiening philologische Modelle, Schulen und Verfahren abklopft.
Die vielleicht größte Stärke und Überraschung seines Buches liegt darin, die Welthaltigkeit der Philologie in sehr unterschiedlichen, scheinbar konträren Projekten auszumachen. Kiening erblickt sie sowohl in einer stark materiell interessierten Forschung etwa zu Manuskripten oder Rekonstruktionsversuchen ursprünglicher Aussprachen als auch in gänzlich abstrakt anmutenden Konzepten wie dem ›Geist‹, der ›Idee‹, der ›Form‹ oder der ›Struktur‹. Seine Studie ist streng historisch angelegt und umfasst den Zeitraum vom späten 19. Jahrhundert bis in die ersten Nachkriegsjahrzehnte. Trotz der Aufarbeitung breiter fachlicher Kontexte und zahlreicher Seitenblicke stehen einige wenige Persönlichkeiten im Zentrum, denen jeweils ein ganzes Kapitel gewidmet ist: der Altphilologe, Mediävist und Paläograph Ludwig Traube, der Mediävist Eduard Sievers, der Neugermanist Rudolf Unger, Walter Benjamin, der Mediävist Hugo Kuhn und der Romanist Erich Auerbach. Ein Kapitel zur Formgeschichte ist breiter angelegt und lässt mehrere Figuren gleichberechtigt auftreten.
Getreu seiner Grundüberzeugung eines ›partizipativen‹ Charakters der Philologie entdeckt Kiening ›Welthaltigkeit‹, ›Wirklichkeit‹, aber auch etwa ›Gegenwärtigkeit‹ sowohl in den Gegenständen als auch und mehr noch in den Arbeitsweisen oder Argumentationsmustern der Philologie. Die Faszination, die etwa für Ludwig Traube von der Schrift ausging, führt Kiening auf deren »doppelte Lebendigkeit« (36) zurück: In Form alter Manuskripte ist sie für den Philologen ein (mehr oder weniger auratisches) Objekt, zugleich repräsentiert sie die Zeit, von der sie Zeugnis ablegt und die es zu entschlüsseln gilt. In diesem Sinn würdigt Kiening ausgiebig Traubes Forschung zu Abkürzungen, da sie dem Impuls folgten, »an kleinsten Erscheinungen Phänomene von weltgeschichtlicher Bedeutung oder zumindest eminenter Welthaftigkeit aufzudecken« (45).
Somit ergibt sich in der Philologie für Kiening gerade keine grundlegende Opposition zwischen Schrift und Stimme, wie sie die Dekonstruktion in der gesamten abendländischen ›Metaphysik‹ am Werk gesehen hatte. Die Versuche von Eduard Sievers, die originären Laute und die Aussprache mittelalterlicher Lyrik zu rekonstruieren, aufzuzeichnen und zu transkribieren, weisen auf struktureller Ebene durchaus Affinitäten zu Traubes Unterfangen auf, obwohl sie primär auf »Reenactment« (58) und »Präsenz« (71) und nicht auf Hermeneutik setzen.
Die Hermeneutik hält Kiening in seinem eigenen methodischen Zugriff allerdings hoch. Dass auf die Kapitel zu Schrift und Stimme eins über den Geist-Begriff Rudolf Ungers – wie über den der Geistesgeschichte insgesamt – folgt, mag zunächst kontraintuitiv wirken. ›Geist‹ versteht Kiening indes nicht als Gegen-, sondern als »Komplementärbegriff zum Materiellen« (75). ›Geist‹ bezeichne bei Unger kein metaphysisches Prinzip, sondern besitze als »Hervorbringer einer inneren Welt […] eine klare Welthaftigkeit«. (88) Auch bleibt die Geistesgeschichte bei der Aufdeckung einer »inneren Welt« Kiening zufolge nicht einfach stehen. Die ihr verpflichteten Geschichtsschreibungen von Tod und Sterben etwa hält er für bedeutende historiographische Vorläufer der Annales-Schule.
Während die ›Welthaltigkeit‹ im Geist-Kapitel trotz sensibler und überzeugender Deutungen im Detail mitunter leicht unscharf zu werden droht, ist Kiening in seinen Überlegungen zur Formgeschichte wieder ganz in seinem Element. Das ist zunächst darauf zurückzuführen, dass Form eine »zugleich konkrete und abstrakte Dimension« (107) aufweise. Sie gehöre der äußeren Welt an, verspreche aber stets, den Schlüssel zum inneren Kern eines Werks oder eben einer inneren Welt bereitzuhalten. Kiening konzediert, dass eine der Form inhärente ›Welthaltigkeit‹ nicht in allen historischen Formkonzepten gleich stark ausgeprägt ist. Im russischen Formalismus etwa tendiere sie gegen Null. An dem langjährigen Standardwerk von André Jolles über »Einfache Formen« hingegen würdigt er ausgiebig das Bemühen, diese in »Bedürfnis- und Interessenszusammenhänge« einzubetten (116). Damit ist es tatsächlich ihre verkappte Welthaltigkeit, die über die Entstehung und Entwicklung bestimmter ›einfacher Formen‹ entscheidet.
Nach der Formgeschichte wendet sich Kiening einer minutiösen Deutung der gescheiterten Habilitationsschrift von Walter Benjamin zu. Es ist ausgerechnet das in der »erkenntnistheoretischen Vorrede« des Trauerspielbuchs so schwerfällig entfaltete Konzept der ›Idee‹, das es Kiening angetan hat und dem er Welthaltigkeit attestiert. Damit kehrt er die Perspektive weiter Teile einer an Benjamin anschließenden Barockforschung radikal um. Während diese über das ganze Brimborium um die »Idee« lieber hinwegsieht, um dem Trauerspiel eine philologisch halbwegs tragbare Realitätsanmutung verleihen zu können,[3] erblickt Kiening in der ›Idee‹ keinen bodenlosen Tiefsinn, sondern eine »›Welt‹ sui generis«, die freilich nicht mit der »empirischen Welt« (129) verwechselt werden dürfe. Der epistemologische Status der ›Idee‹ sei bei Benjamin zwar ausgesprochen fragil, ermögliche es ihm jedoch genau deshalb, »etwas ans Licht treten zu lassen, ohne es zu erfinden« (136). ›Welthaltigkeit‹ ist demnach für Kiening nie eine handfeste Ausbeute, sondern mehr eine Art Nimbus. Wiederholt bringt er die Kategorie des ›Zarten‹ ins Spiel, wenn er ›Welthaltigkeit‹ begrifflich zu konturieren versucht. In Benjamins Trauerspielbuch blitze ›Welthaltigkeit‹ gerade in der »Unschärfe« der gesamten »Methode« (148) auf.
Ähnliches gelte für die Begriffe der ›Form‹ und der ›Struktur‹ in der Überlieferungsphilologie Hugo Kuhns. Auch hier würdigt Kiening ausdrücklich die Flexibilität oder Offenheit solcher Konzepte. Mit ›Form‹ sei bei Kuhn nicht allein eine konkrete, existente oder greifbare Form gemeint, sondern auch die »prägende Kraft der Formbildung« (172) selbst. ›Form‹ und ›Struktur‹ zeugten bei Kuhn folglich von einer »Bindung an die Wirklichkeit« (172), da sie die »Entscheidung, ob es sich um Bewusstseins- oder Seinsstrukturen« handelt, bewusst offenhielten (172).
Vergleichbare Denkfiguren deckt Kiening abschließend in vielen Schriften Erich Auerbachs auf. Die Typologie etwa betrachtet er als philologischen Entwurf einer Form, in der sich Immanenz und Transzendenz »verschränken« (189). Besonders fasziniert ihn Auerbachs Mut, zentrale Begriffe wie ›Mimesis‹ oder ›Wirklichkeit‹ »definitorisch« gerade nicht »zu fixieren« (194). Auerbachs groß angelegten Versuch einer Geschichtsschreibung des literarischen Realismus liest Kiening subtil als Geschichte von dessen »Verhinderung« (198). Dem sukzessiven Zurücktreten eines Interesses an der ›Wirklichkeit‹ korrespondiere beim späteren Auerbach ein »Hervortreten des Weltbegriffs« (200). Dieser münde aber nie in eine solide »Weltanschauung« ein, sondern bezeichne ein »Weltverhältnis« (203).
In den sehr dichten Passagen zu Auerbach erteilt Kiening zwischen den Zeilen nicht zuletzt Auskunft über das eigene Verfahren. Er geht mit der ›Welthaltigkeit‹ definitorisch genauso lax um wie Auerbach mit der ›Wirklichkeit‹. Hierin liegt aber keine Nachlässigkeit, sondern eine bewusste Entscheidung für gedankliche Elastizität. Auch Kiening ist es mitnichten um den Entwurf einer ›Weltanschauung‹ zu tun, sondern um die Aufarbeitung des reichen Spektrums an ›Weltverhältnissen‹, das die Geschichte der Philologie bereithält.
Welthaltigkeit ist für Kiening nichts, was eindeutig gegenständlich werden oder unmittelbar zu sich selbst kommen könnte. Insofern ist es konsequent, wenn er in einem kurzen Ausblick feststellt, der Weltbegriff sei »ebenso wenig einzuholen wie aufzugeben« (206). Auf den letzten Seiten heißt es an zentraler Stelle:
»Im Wechselspiel von Literatur und Literaturwissenschaft hat auch der Philologe teil an der Hervorbringung von Welt – zum Beispiel, indem er die richtigen Fragen stellt.« (208)
In einer Gegenwart, in der sich die Geisteswissenschaften immer eindeutigere Positionen und immer klarere Antworten oder gar Anweisungen abverlangen, ist dies ein unzeitgemäßes Credo. Aber wenn die Philologie tatsächlich genau dort an Welthaltigkeit gewinnen sollte, wo sie an Bodenständigkeit verliert – was ließe sich Größeres über sie sagen?
Der Literaturwissenschaftler Claude Haas ist stellvertretender Direktor des ZfL und leitet gemeinsam mit Matthias Schwartz den Programmbereich Weltliteratur.
[1] Markus Gabriel: Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013.
[2] Vgl. zum Klassiker dieser Tendenz Emily Apter: Against World Literature. On the Politics of Untranslatability, London/New York 2013. Die Forschung zu den Diskussionen um den Begriff der ›Weltliteratur‹ ist unüberschaubar. Vgl. zuletzt den Überblick bei Vittoria Borsò/Schamma Schahadat (Hg.): Grundthemen der Literaturwissenschaft: Weltliteratur, Berlin/Boston 2025.
[3] Vgl. vor allem Bettine Menke: Das Trauerspiel-Buch. Der Souverän – das Trauerspiel – Konstellationen – Ruinen, Bielefeld 2010.
VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE: Claude Haas: Ein Fach von Welt. Zu einem Plädoyer für die Welthaltigkeit der Philologie, in: ZfL Blog, 6.1.2026, [https://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2026/01/06/claude-haas-ein-fach-von-welt-zu-einem-plaedoyer-fuer-die-welthaltigkeit-der-philologie/].
DOI: https://doi.org/10.13151/zfl-blog/20260106-01

